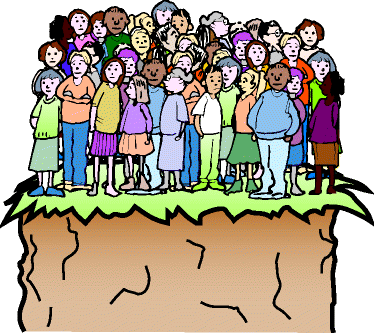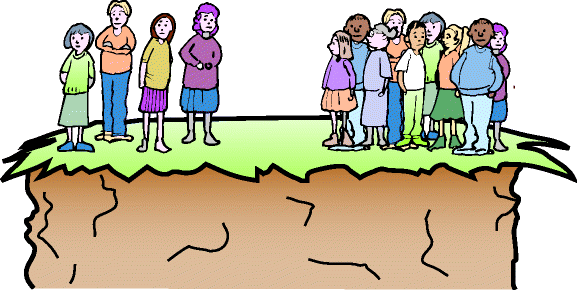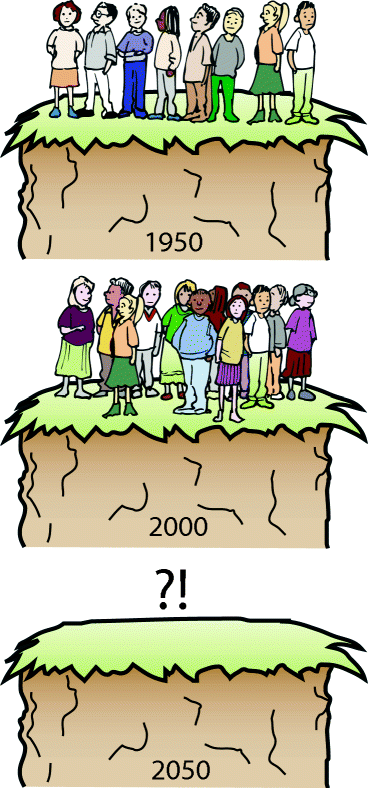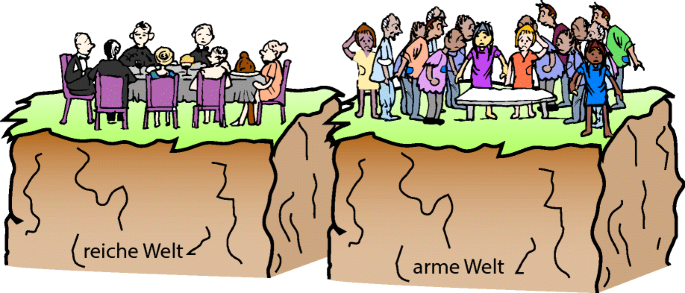Zusammenfassung
In diesem Kapitel werden wir erörtern, wie wir mithilfe der Ökologie besser verstehen können, welche Probleme das menschliche Bevölkerungswachstums, Krankheiten, die Landwirtschaft und der Ressourcenverbrauch mit sich bringen. Selbstverständlich hat alleine schon das Wachstum der menschlichen Bevölkerung Auswirkungen auf die Umwelt und die natürlichen Ökosystemfunktionen, genauso wesentlich sind aber der beträchtliche Anstieg des Pro-Kopf-Verbrauchs und der diesem zugrunde liegende stetige Ausbau neuer Technologien (Abb. 14.1). In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Weltbevölkerung um 40 % angewachsen – von 1,8 auf 2,5 Mrd. Menschen. Seither hat sich Bevölkerung beinahe verdreifacht auf über 7 Mrd. Menschen. Das globale Bruttoinlandsprodukt (engl. gross domestic production) ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts um 75 % angestiegen – von 3 auf 5,3 Bio. US-Dollar – und seitdem sogar um mehr als das Zehnfache auf 55 Bio. US-Dollar. Welche Konsequenzen hat dieser Wohlstand? Der Verbrauch von Nahrung, Energie und materiellen Gütern hat erheblich zugenommen – mit entsprechend gravierenden Folgen auf lokaler und globaler Ebene. Die Ökologie kann als Wissenschaft dazu beitragen, diese Folgen besser zu verstehen und Möglichkeiten für einen nachhaltigeren Fortschritt zu finden.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Nach Lesen dieses Kapitels werden Sie:
-
erklären können, auf welche Weise die wachsende menschliche Bevölkerung mit ihrem erhöhten Ressourcenverbrauch Druck auf die Umwelt ausübt.
-
die Ursachen und Probleme der globalen Überbevölkerung benennen können.
-
darlegen können, wie die menschliche Gesundheit durch Wechselwirkungen mit dem lokalen und dem globalen Ökosystem beeinflusst wird.
-
rückschauend erläutern können, wie sich der zunehmende Einsatz von synthetischen Stickstoffdüngern in den letzten 50 Jahren bemerkbar gemacht hat.
-
aufzeigen können, welche Vor- und Nachteile eine chemische bzw. biologische Schädlingsbekämpfung hat und warum landwirtschaftliche Monokulturen die Vermehrung von Schädlingen begünstigen.
-
darlegen können, welchen Einschränkungen die Produktion von Nahrung für die Weltbevölkerung unterliegt.
-
beschreiben können, wie die Fischereiressourcen der Erde durch Überfischung erschöpft wurden und welche Folgen Aquakulturen für die Umwelt haben.
Durch das Anwachsen der menschlichen Bevölkerung, die Entwicklung neuer Technologien und den Anstieg des Pro-Kopf-Verbrauchs hat der Mensch immer stärkeren Einfluss auf die Landschaft und die Erde insgesamt genommen. Physische Degradation und Belastung durch Chemikalien aus der Landwirtschaft, Ressourcenverbrauch, Verstädterung und Industrie haben sich nachteilig auf die Gesundheit des Menschen und auch auf zahlreiche Ökosystemdienstleistungen ausgewirkt, die in hohem Maße zum Wohlergehen des Menschen beitragen. Unsere Umweltprobleme haben eine ökologische, ökonomische und sozialpolitische Dimension. Um Lösungen dafür zu finden, ist daher ein multidisziplinärer Ansatz erforderlich.
1 Der Verbrauch ökologischer Ressourcen durch den Menschen
In diesem Kapitel werden wir erörtern, wie wir mithilfe der Ökologie besser verstehen können, welche Probleme das menschliche Bevölkerungswachstum, Krankheiten, die Landwirtschaft und der Ressourcenverbrauch mit sich bringen. Selbstverständlich hat alleine schon das Wachstum der menschlichen Bevölkerung Auswirkungen auf die Umwelt und die natürlichen Ökosystemfunktionen, genauso wesentlich sind aber der beträchtliche Anstieg des Pro-Kopf-Verbrauchs und der diesem zugrunde liegende stetige Ausbau neuer Technologien (Abb. 14.1). In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Weltbevölkerung um 40 % angewachsen – von 1,8 auf 2,5 Mrd. Menschen. Seither hat sich Bevölkerung beinahe verdreifacht auf über 7 Mrd. Menschen. Das globale Bruttoinlandsprodukt (engl. gross domestic production) ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts um 75 % angestiegen – von 3 auf 5,3 Bio. US-Dollar – und seitdem sogar um mehr als das Zehnfache auf 55 Bio. US-Dollar. Welche Konsequenzen hat dieser Wohlstand? Der Verbrauch von Nahrung, Energie und materiellen Gütern hat erheblich zugenommen – mit entsprechend gravierenden Folgen auf lokaler und globaler Ebene. Die Ökologie kann als Wissenschaft dazu beitragen, diese Folgen besser zu verstehen und Möglichkeiten für einen nachhaltigeren Fortschritt zu finden.
Der Mensch belastet die globale Umwelt zunehmend, beispielsweise durch die Auswirkungen seines Bevölkerungswachstums, durch zunehmenden Wohlstand und einen höheren Pro-Kopf-Verbrauch sowie die Entwicklung neuer Technologien (aus Kolbert 2011)
Aber nicht nur die Weltbevölkerung ist angewachsen, auch der Anteil der Menschen, die in Städten leben, ist ständig gestiegen (Abb. 14.2). Im Jahr 2010 lebten erstmals in der Menschheitsgeschichte ebenso viele Menschen in Städten wie in ländlichen Regionen. Nach Prognosen der Vereinten Nationen wird sich dieser Trend noch weiter fortsetzen, sodass 2050 rund zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben werden. In gewisser Weise entlastet dieser Trend aber die Umwelt: Beispielsweise sind die Pro-Kopf-Emissionen an Treibhausgasen für Stadtbewohner in der Regel weitaus niedriger als in der Bevölkerung insgesamt. Allerdings benötigen die Städte selbst Raum und ersetzen ländlich geprägte Landstriche mit landwirtschaftlichen und natürlichen Ökosystemen. Außerdem sind sie Orte erhöhter Luft- und Wasserverschmutzung, weil hier auf engem Raum große Mengen an Energie und Ressourcen verbraucht und Abwässer produziert werden. Ermöglicht wurde die wachsende Urbanisierung durch die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft. Mit dem Anstieg der Produktivität pro Fläche durch den Einsatz von Düngemitteln und fossilen Brennstoffen – etwa zum Antrieb von Traktoren, Bewässerungssystemen usw. – mussten immer weniger Menschen auf den Feldern arbeiten.
Die Weltbevölkerung insgesamt sowie die in ländlichen Regionen und in Städten lebende Bevölkerung von 1950 bis 2010, ergänzt durch Prognosen der Vereinten Nationen für die zukünftige Entwicklung bis 2050 (aus UNEP 2014)
Wie schon in Kap. 11 erwähnt, nutzt der Mensch bereits einen hohen Anteil der globalen Nettoprimärproduktivitität (NPP) für seine Zwecke (Abb. 11.2). In Zukunft werden die Menschen sogar noch einen höheren Prozentsatz der NPP nutzen, weil der Nahrungsverbrauch steigen wird und mehr Nutzpflanzen zur Produktion von Biotreibstoffen angebaut werden. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch an Nahrungsmitteln ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, von täglich 2360 kcal Mitte der 1960er-Jahre auf heute 2940 kcal (World Health Organization 2013b). Nach Angaben der U. S. National Institutes of Health reichen für einen Erwachsenen bei moderater Aktivität 2250 kcal am Tag aus. Natürlich stellen Hunger und Unterernährung in vielen Regionen der Erde nach wie vor ein großes Problem dar – rund 1 Mrd. Menschen ist nicht ausreichend ernährt. Doch selbst in den Entwicklungsländern hat der Verbrauch von täglich 2054 kcal in den 1960er-Jahren auf heute 2850 kcal zugenommen. Warum müssen dennoch viele Menschen hungern? Das liegt aktuell nicht daran, dass weltweit nicht genügend Nahrungsmittel produziert werden, sondern an der ungleichen Verteilung dieser Nahrungsmittel. Tatsächlich sind Gesundheitsbehörden zunehmend besorgt über den übermäßigen Verbrauch von Nahrungsmitteln: Die Zahl Fettleibiger hat sich in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt und mehr als ein Drittel der Erwachsenen weltweit leiden unter Übergewicht (World Health Organization 2013b). Nichtsdestotrotz ist zu erwarten, dass die Nahrungsproduktion global gesehen weiterhin zunehmen wird.
2 Das Problem des Bevölkerungswachstums
Die Ursache der meisten – wenn nicht sogar aller – Umweltprobleme, mit denen wir konfrontiert sind, ist die große und immer weiter anwachsende menschliche Bevölkerung. Mehr Menschen bedeuten einen größeren Bedarf an Energie, an nichterneuerbaren Ressourcen wie Erdöl und Mineralien, an erneuerbaren Ressourcen wie Fisch und Wäldern und an Nahrungsmitteln, die durch die Landwirtschaft produziert werden müssen. So wie bisher, kann es zweifellos nicht weitergehen. Obgleich immer noch nicht so ganz klar ist, worin das Problem tatsächlich liegt (Exkurs 14.1). Zunächst werden wir uns mit der Größe und Wachstumsrate der Weltbevölkerung befassen und darauf eingehen, wie der gegenwärtige Zustand erreicht wurde und wie genau die Vorhersagen für die Zukunft sind. Schließlich stellen wir uns noch die Frage: „Wie viele Menschen kann die Erde verkraften?“
2 Exkurs 14.1 Aktueller ÖKOnflikt
2 Worin genau besteht das Bevölkerungsproblem?
Worin besteht eigentlich das Bevölkerungsproblem? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, im Folgenden sind dennoch einige mögliche Antworten darauf aufgeführt (Cohen 1995, 2003, 2005). Das tatsächliche Problem könnte durchaus eine Kombination aus diesen Aspekten sein. Es bestehen jedoch kaum Zweifel, dass ein Problem besteht und dass dieses Problem uns alle gemeinsam angeht.
-
Die gegenwärtige Größe der Weltbevölkerung ist nicht auf Dauer tragbar: Im Jahr 200 n. Chr. gab es auf der Erde etwa 2,5 Mio. Menschen. Damals schrieb Quintus Septimus Florens Tertullianus: „Wir sind eine Belastung für die Erde, ihre Ressourcen werden kaum ausreichen für uns.“ Bis zum Jahr 2013 war die Weltbevölkerung auf schätzungsweise 7 Mrd. Menschen angewachsen.
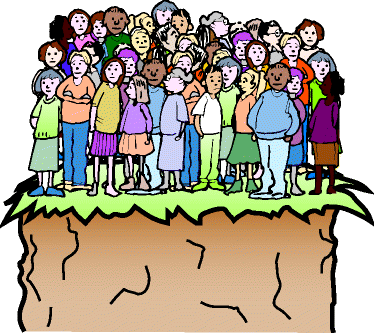
-
Es ist nicht die Größe der Weltbevölkerung, sondern ihre Verteilung auf der Erde, die nicht auf Dauer tragbar ist: Der Anteil der Bevölkerung in Städten ist von rund 3 % um 1800 auf heute mehr als 50 % angestiegen. Jeder in der Landwirtschaft Beschäftigte muss heute sich selbst und zusätzlich einen Stadtbewohner ernähren, im Jahr 2050 werden es sogar zwei Stadtbewohner sein (Cohen 2005).
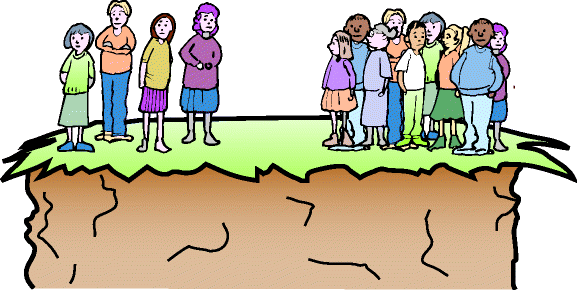
-
Die gegenwärtige Wachstumsrate der Weltbevölkerung ist untragbar hoch: Vor der landwirtschaftlichen Revolution im 18. Jahrhundert hatte die Weltbevölkerung ungefähr 1000 Jahre gebraucht, um sich zu verdoppeln. Die jüngste Verdopplung vollzog sich in nur 39 Jahren (Cohen 2001).
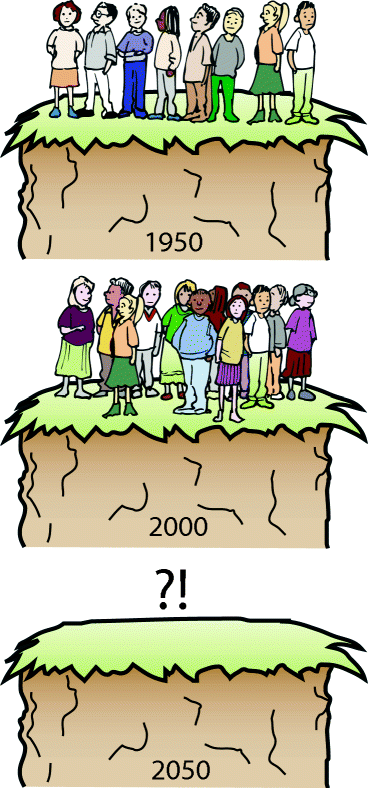
-
Es ist nicht die Größe, sondern die Altersstruktur der Weltbevölkerung, die nicht auf Dauer tragbar ist: In den industrialisierten Regionen der Erde stieg der Anteil der älteren Bevölkerung über 65 Jahre von 7,6 % im Jahr 1950 auf 12,1 % 1990. Mittlerweile nimmt dieser Anteil noch schneller zu, weil die große Gruppe der nach dem Zweiten Weltkrieg geborenen Menschen nun das 65. Lebensjahr überschritten hat.

-
Es ist nicht die Begrenzung der Ressourcen, sondern ihre ungleiche Verteilung unter der Weltbevölkerung, die nicht auf Dauer tragbar ist: Im Jahr 1992 lag das Jahreseinkommen der rund 830 Mio. Menschen in den reichsten Ländern der Erde im Schnitt umgerechnet bei 22.000 US-Dollar. Die 2,6 Mrd. Menschen in den Ländern mit mittlerem Einkommen verdienten im Schnitt jährlich 1600 US-Dollar. Hingegen mussten die 2 Mrd. Menschen in den ärmsten Ländern mit nur 400 US-Dollar auskommen. Und auch hinter diesen Mittelwerten verbergen sich noch enorme Ungleichheiten.
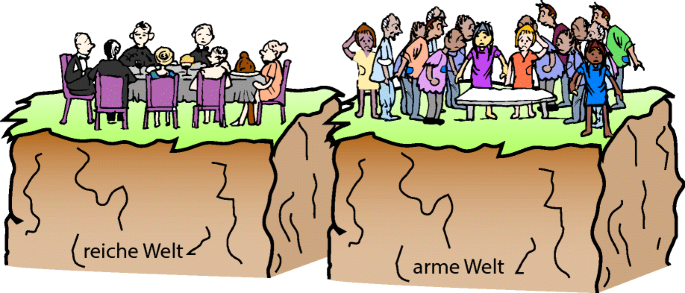
-
Welche Rolle oder Verantwortung kommt dem Einzelnen im Gegensatz zum Staat bei der Lösung des Bevölkerungsproblems zu?
-
Welche der fünf oben aufgelisteten Varianten des Bevölkerungsproblems betreffen ganz besonders die Beziehung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern bzw. zwischen Reich und Arm?
2.1 Das Bevölkerungswachstum bis heute
Bei einem exponentiellen Wachstum (Kap. 5) nimmt die Population als Ganzes mit zunehmender Rate zu (bei der Auftragung der Anzahl in Abhängigkeit von der Zeit zeigt die Kurve nach oben). Das liegt einfach daran, dass die Wachstumsrate ein Produkt der individuellen Rate (die konstant ist) und der zunehmenden Zahl von Individuen ist. Wie Abb. 14.3 zeigt, verlief das Wachstum zwar über Tausende von Jahren hinweg durchaus exponentiell, aber sehr langsam. Nur vor 10.000 Jahren machte es mit Beginn der Landwirtschaft einen Sprung. Während kurzer Zeiträume, etwa zur Zeit der Pest in Europa vor rund 700 Jahren, ging die Weltbevölkerung sogar zurück. Mit der zunehmenden Urbanisierung und Industrialisierung beschleunigte sich das Wachstum dann und verlief mehrere Jahrhunderte lang überexponentiell. Vor Kurzem hat es sich jedoch wieder verlangsamt, wie wir weiter unten sehen werden.
Die geschätzte Größe der Weltbevölkerung in den letzten 30.000 Jahren, ergänzt durch einen Ausblick in die Zukunft (nach Population Reference Bureau 2006)
2.2 Vorhersagen für die Zukunft
Anhand der Entwicklung der menschlichen Bevölkerung in der Vergangenheit können wir Vorhersagen für zukünftige Populationsgrößen und Wachstumsraten treffen. Einfach die Vergangenheit auf die Zukunft zu projizieren würde jedoch bedeuten, von der mit Sicherheit falschen Annahme auszugehen, dass die Bedingungen in der Zukunft genauso sein werden wie in der Vergangenheit. Um wirklich eine Vorhersage treffen zu können, müssen wir zunächst verstehen, was in der Vergangenheit passiert ist, wie sich die Gegenwart davon unterscheidet und wie sich diese Unterschiede in zukünftigen Mustern des Bevölkerungswachstums niederschlagen könnten. Insbesondere müssen wir uns klar machen, dass die menschliche Bevölkerung wie alle ökologischen Populationen heterogen ist.
Als demografischen Übergang (engl. demographic transition) bezeichnet man eine Verschiebung von hohen zu niedrigen Geburten- und Sterberaten. Auf dieser Basis können wir drei Teilpopulationen der menschlichen Bevölkerung unterscheiden: Bei der ersten hat der demografische Übergang schon sehr früh – vor 1945 – stattgefunden (Abb. 14.4), bei der zweiten spät – nach 1945 – und bei der dritten ist er noch gar nicht erfolgt. Der Verlauf sieht folgendermaßen aus: Zu Beginn sind sowohl die Geburten- als auch die Sterberate hoch, aber Erstere liegt nur etwas höher als Letztere, sodass die Wachstumsrate der Bevölkerung insgesamt nur gering ausfällt. Es ist davon auszugehen, dass dies in allen menschlichen Populationen in weiten Teilen der Vergangenheit der Fall war. Als Nächstes geht die Sterberate zurück, während die Geburtenrate gleich hoch bleibt. Dadurch steigt die Wachstumsrate an. Anschließend nimmt jedoch auch die Geburtenrate ab, bis sie ähnlich hoch oder sogar niedriger ist als die Sterberate. Folglich geht die Wachstumsrate der Bevölkerung wieder zurück – oder wird mitunter sogar negativ, sofern die Sterberate die Geburtenrate übersteigt –, allerdings ist die Bevölkerung dann schon viel größer als zum Zeitpunkt vor Beginn des Übergangs.
Geburten- und Sterberaten in Europa seit 1850. Die jährliche Nettowachstumsrate entspricht dem Abstand zwischen den beiden Kurven (nach Cohen 1995)
Als Erklärung für diesen demografischen Übergang wird häufig darauf verwiesen, er sei eine unausweichliche Folge von Industrialisierung, Bildung und genereller Modernisierung. Diese Faktoren führten zunächst aufgrund von medizinischen Fortschritten zu einer Abnahme der Sterberaten. Anschließend komme es durch bewusste Entscheidungen der Menschen – etwa, erst spät Kinder zu bekommen – zu einem Rückgang der Geburtenraten. Wenn wir die Bevölkerungen der verschiedenen Regionen der Erde alle zusammen betrachten, erkennen wir einen dramatischen Rückgang von der höchsten jährlichen Wachstumsrate von etwa 2,1 % in den Jahren 1965–1970 auf rund 1,1–2,1 % heute (Abb. 14.5a). Zwar nahm die Wachstumsrate auch in der Vergangenheit bisweilen ab, beispielsweise bedingt durch die Pest oder Kriege, aber nie zuvor, so Cohen (2005), erfolgte dieser Rückgang „aus freiem Entschluss“.
a Die durchschnittliche jährliche prozentuale Veränderung der Weltbevölkerung von 1950–2010, ergänzt durch Vorhersagen bis 2100 auf der Basis verschiedener Annahmen zu künftigen Geburtenziffern (engl. fertility rate). b Die geschätzte Größe der Weltbevölkerung von 1950–2010, ergänzt durch Vorhersagen bis 2100 auf der Basis verschiedener Annahmen hinsichtlich der Geburtenziffern. c Die geschätzte Größe der Bevölkerungen der Kontinente der Erde von 1950–2010, ergänzt um Vorhersagen bis 2100 unter der Annahme einer mittleren Geburtenziffer (nach United Nations 2011)
2.3 Zwei unvermeidliche Entwicklungen
Wäre das Bevölkerungsproblem gelöst, wenn es gelänge, in allen Ländern der Erde einen demografischen Wandel herbeizuführen, sodass die Geburten- gleich den Sterberaten wären und damit ein Nullwachstum vorläge? Sicherlich nicht, und zwar aus mindestens zwei wesentlichen Gründen. Der erste Grund lautet: Es besteht ein großer Unterschied in der Altersstruktur von Populationen mit gleicher Geburten- und Sterberate, je nachdem, ob diese hoch oder niedrig sind. Wie wir in Kap. 5 gesehen haben, spiegelt die Nettoreproduktionsrate einer Population das altersabhängige Muster von Überleben und Geburten wider. Eine bestimmte Nettoreproduktionsrate kann jedoch durch eine praktisch unendliche Zahl unterschiedlicher Kombinationen von Geburten- und Sterberaten erzielt werden. Diese Kombinationen selbst führen zu unterschiedlichen Altersstrukturen innerhalb der jeweiligen Population. Bei hoher Geburten-, aber niedriger Überlebensrate – also der Situation vor dem demografischen Übergang – umfasst eine Population viele junge und relativ wenige alte Individuen. Ist hingegen die Geburtenrate niedrig und die Überlebensrate hoch – also beim angestrebten Idealfall nach dem demografischen Übergang –, so sind zwangsläufig relativ wenige, produktive junge Individuen für die Versorgung vieler alter, unproduktiver, abhängiger Individuen zuständig. Größe und Wachstumsrate der menschlichen Bevölkerung stellen also nicht die einzigen Probleme dar: Ein weiteres bildet die Altersstruktur der Bevölkerung (Abb. 14.6).
Angenommen, wir verfügten über so fortschrittliche Erkenntnisse und eine so umfassende Macht, dass wir schon morgen für gleiche Geburten- und Sterberaten sorgen könnten. Würde das Bevölkerungswachstum dann zum Stillstand kommen? Auch in diesem Fall lautet die Antwort „Nein“ – und zwar aus dem zweiten Grund: Das Bevölkerungswachstum hat seine eigene Dynamik und selbst bei angeglichener Geburten- und Sterberate würde es noch viele Jahre dauern, bis sich eine stabile Altersstruktur einstellt. Unterdessen würde sich das Bevölkerungswachstum jedoch weiterhin fortsetzen. Laut Vorhersagen der Vereinten Nationen wird die Weltbevölkerung selbst bei geringen Geburtenziffern bis 2050 weiterhin leicht anwachsen, von derzeit etwas mehr als 7 Mrd. Menschen auf mehr als 8 Mrd. (Abb. 14.5b). Heute leben auf der Erde beispielsweise sehr viel mehr Säuglinge als noch vor 25 Jahren. Selbst wenn jetzt die Geburtenrate pro Kopf beträchtlich sinkt, wird es in 25 Jahren erheblich mehr Geburten geben als heute. Und auch durch diese Kinder wird sich wiederum die Dynamik fortsetzen, bevor schließlich irgendwann eine stabile Altersstruktur erreicht ist. Wie Abb. 14.5c zeigt, wird die von jungen Menschen dominierte Bevölkerung in den Entwicklungsländern der Erde am meisten zur Dynamik des weiteren Bevölkerungswachstums beitragen.
2.4 Wie groß ist die globale Umweltkapazität?
Die gegenwärtige Wachstumsrate der Weltbevölkerung ist nicht auf Dauer tragbar, obschon sie heute geringer ist als früher. In einem endlichen Raum mit endlichen Ressourcen kann keine Population ständig weiter anwachsen. Um eine geeignete Lösung für das Problem vorschlagen zu können, benötigen wir eine Art Zielvorgabe, wie viele Menschen die Erde verkraften kann. Die im Laufe der letzten 300 Jahre vorgeschlagenen Schätzungen hatten eine erstaunliche Schwankungsbreite und selbst die Schätzwerte seit den 1970er-Jahren unterscheiden sich um drei Zehnerpotenzen und reichen von 1 bis zu 1000 Mrd. Betrachten wir einige Beispiele, um zu veranschaulichen, welche Schwierigkeiten es bereitet, eine vernünftige Einschätzung der Umweltkapazität zu erhalten (für weitere Einzelheiten zu den unten genannten Autoren s. Cohen 1995, 2005).
Der niederländische Naturforscher Antoni van Leeuwenhoek schätzte im Jahr 1679 die besiedelte Fläche der Erde 13.385-mal größer ein als seine Heimat Holland, das damals rund 1 Mio. Einwohner hatte. Unter der Annahme, die gesamte Fläche könne so dicht besiedelt sein wie Holland, kam er auf eine Obergrenze von ungefähr 13,4 Mrd. Menschen. Im Jahr 1967 fragte sich der Pflanzenpopulationsökologe C. T. de Wit, wie viele Menschen auf der Erde leben können, wenn die Photosynthese der limitierende Prozess ist. Er kam auf eine Zahl von 1000 Mrd. – unter der Annahme, dass die Wachstumsperiode mit dem Breitengrad variiert, dass aber weder Wasser noch Mineralstoffe limitierende Faktoren darstellen. Sofern die Menschen Fleisch essen oder eine angemessene Fläche als Lebensraum haben möchten, gelangte de Wit zu einem niedrigeren Wert.
Im Gegensatz dazu steht die Annahme von H. R. Hulett von 1970, das Niveau von Wohlstand und Verbrauch in den Vereinigten Staaten sei optimal für die gesamte Erde, wobei er nicht nur den Bedarf an Nahrung, sondern auch an erneuerbaren Ressourcen wie Holz und nichterneuerbaren Ressourcen wie Stahl und Aluminium berücksichtigte. Er errechnete eine Obergrenze von maximal 1 Mrd. Menschen. In einer Reihe von Publikationen aus dem Jahr 1988 gelangten Kates et al. zu ähnlichen Annahmen, wobei sie globale Durchschnittswerte zugrunde legten und nicht solche für die Vereinigten Staaten. Nach ihrer Berechnung liegt die Umweltkapazität der Erde bei einer einfachen, überwiegend vegetarischen Ernährung bei 5,9 Mrd. Menschen, bei einer „aufgebesserten“ Ernährung mit rund 15 % der aufgenommenen Kalorien aus tierischen Produkten bei 3,9 Mrd. und bei einer Deckung von 25 % des Kalorienbedarfs aus tierischen Produkten bei 2,9 Mrd. Menschen.
In jüngerer Zeit versuchten Wackernagel et al. (2002) zu quantifizieren, welche Fläche an Land die Menschheit für ihre Versorgung mit Ressourcen und die Entsorgung ihrer Abfälle benötigt – verkörpert durch ihr Konzept des ökologischen Fußabdrucks (engl. ecological footprint). Sie gelangten zu der vorläufigen Einschätzung, dass der Mensch 1961 70 % und 1999 120 % der Kapazität der Biosphäre nutzte – mit anderen Worten, die globale Umweltkapazität sei bereits vor der Jahrtausendwende, bei einer Weltbevölkerung von rund 6 Mrd., überschritten gewesen.
Cohen (2005) hat darauf hingewiesen, dass viele Schätzungen ganz oder weitgehend auf nur einem einzigen Parameter beruhen – etwa auf der biologisch produktiven Landfläche, der Versorgung mit Wasser, Energie, Nahrung usw. In der Realität hängt der Einfluss eines dieser Parameter allerdings vom Wert der anderen ab. Sofern beispielsweise Wasser knapp, Energie jedoch im Überfluss vorhanden ist, kann man Wasser entsalzen und dorthin transportieren, wo Wassermangel herrscht. Bei hohen Energiekosten kommt diese Lösung nicht infrage. Wie die oben genannten Beispiele verdeutlichen, besteht ein Unterschied zwischen der Zahl der Menschen, die die Erde grundsätzlich ernähren kann, und der Zahl, die sie bei einem akzeptablen Lebensstandard ernähren kann. Die höheren Schätzwerte kommen dem Konzept der Umweltkapazität nahe, wie wir es in der Regel auf andere Organismen anwenden (Kap. 5) – einer Zahl, die durch die begrenzten Ressourcen der Umwelt determiniert wird. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich die meisten Menschen mit einem Leben an der Kapazitätsgrenze zufrieden geben oder dies ihren Nachfahren wünschen.
Auf jeden Fall gehen wir schon weit mit unserer Annahme, dass die menschliche Bevölkerung von unten her (Bottom-up) durch ihre Ressourcen begrenzt ist und nicht von oben her (Top-down) durch ihre natürlichen Feinde. Allerdings werden Infektionskrankheiten – vor nicht allzu langer Zeit noch als weitgehend besiegt betrachtet – inzwischen wieder als große Bedrohung für das Wohlergehen der Menschheit wahrgenommen. Wie wir in Kap. 7 gesehen haben, entwickeln sich zahlreiche Infektionskrankheiten am besten bei hohen Populationsdichten. Im folgenden Abschnitt werden wir uns etwas näher mit der menschlichen Gesundheit befassen.
3 Ökologie und Gesundheit des Menschen
Wie wir in Kap. 13 gesehen haben, ist der Verlust von Biodiversität und einzelnen Arten an sich schon bedauernswert, vor allem aber auch aufgrund seiner indirekten Auswirkungen auf Wohlergehen und Lebensqualität des Menschen. Die menschliche Gesundheit ist jedoch auch noch direkter von den ökologischen Veränderungen betroffen, die um uns herum ablaufen.
3.1 Schwinden der Ozonschicht
Ein Beispiel dafür bildet das Schwinden der Ozonschicht in der Stratosphäre (Abschn. 12.4). Das stratosphärische Ozon absorbiert ultraviolette Strahlung (UV-Strahlung). Dadurch gelangt nur eine geringere Menge an UV-Strahlung bis auf die Erdoberfläche, wo sie beträchtliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben kann. Die Abnahme des Ozons in der Stratosphäre begann in den 1970er-Jahren mit einer Rate von 4 % pro Jahrzehnt. Als dramatischster Effekt bildete sich über der Antarktis ein immer größer werdendes Ozonloch (Shanklin 2010, Abb. 14.7), aber die Ozonkonzentration ging weltweit zurück. Zu diesem Rückgang tragen unter anderem natürlich vorkommende chemische Verbindungen wie das auch als Lachgas bekannte Distickstoffmonoxid (N2O, engl. nitrous oxide; Abschn. 12.4) bei. Eine bahnbrechende Entdeckung offenbarte jedoch als Hauptursache die Anreicherung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW, engl. chlorofluorocarbons) in der Atmosphäre. Diese werden als Kühlmittel hergestellt und erwiesen sich als besonders wirkungsvolle Katalysatoren bei der Zerstörung der Ozonschicht. Als Reaktion darauf wurde 1987 das Montrealer Protokoll verabschiedet, das die Unterzeichner verpflichtete, die Verwendung von FCKW weltweit zunächst zu reduzieren und schließlich ganz einzustellen. Dieses Abkommen stellte sich als außerordentlich hilfreich heraus: Die Rate der Ozonabbaus konnte dadurch deutlich verringert werden. Das Distickstoffmonoxid kann allerdings eine ähnliche Rolle bei der Zerstörung der Ozonschicht spielen wie die FCKW. Sein Effekt auf die Ozonschicht nahm zu, weil seine Konzentrationen weiterhin ansteigen – eine der zahlreichen Konsequenzen der Beschleunigung des globalen Stickstoffkreislaufs durch den Menschen. Dadurch stellt das Schwinden der Ozonschicht nach wie vor ein bedenkliches Problem dar.
Darstellung des Ozonlochs über der Antarktis kurz nach seiner Entdeckung im Jahr 1979 und im Jahr 2008 (nach Shanklin 2010, NASA-Bilder mit freundlicher Genehmigung des Goddard Space Flight Center Ozone Processing Team)
Die erhöhte UV-Strahlung aufgrund der verminderten Ozonschicht hatte auch gesundheitliche Folgen, unter anderem eine steigende Hautkrebsrate. Abbildung 14.8 zeigt hierzu Daten aus Nordirland. Diesen zunehmenden Bedrohungen stehen wir jedoch keineswegs hilflos gegenüber. So hat zum Beispiel in Australien Wirkung gezeigt, dass man die Bedrohung hier besonders ernst nahm und umfassende Informationskampagnen durchführte: Trotz des erhöhten Risikos hat sich die Inzidenz des auch als schwarzer Hautkrebs bezeichneten malignen Melanoms bei Männern stabilisiert und ist bei Frauen sogar zurückgegangen.
Inzidenz des malignen Melanoms (schwarzer Hautkrebs) in Nordirland seit 1984. Die Kurven der Trends sind signifikant (p < 0,05). Für Männer verlangsamte sich die Zunahme nach 1995, Ähnliches gilt auch für Frauen (nach Montella et al. 2009)
3.2 Klimatische Extreme
Verschiedene Veränderungen der Atmosphäre haben zu einem Wandel der globalen Klimamuster geführt (Kap. 12). Die Durchschnittswerte ändern sich – beispielsweise steigt die durchschnittliche globale Temperatur an –, es kommt aber auch häufiger zu extremen Klimaereignissen. Dazu gehören laut Definition eines internationalen Expertenteams (Expert Team on Climate Change Detection Monitoring und Indices, ETCCDMI) Hitzewellen, Überflutungen, Dürren, starke Stürme usw. In Abb. 14.9 sind die Verhältnisse in der Vergangenheit sowie Vorhersagen für die Zukunft für ein solches Klimaextrem dargestellt: die jährliche Zahl von Tropennächten in Europa – Nächte mit Temperaturen über 20 °C – als Hinweis auf eine Hitzewelle. Zur Validierung der Vorhersagen verglich man die Ergebnisse des dafür ausgewählten Klimamodells (Abb. 14.9) zunächst mit den bis heute tatsächlich beobachteten Werten. Dabei zeigte sich eine recht gute Übereinstimmung. Anschließend erstellte man mithilfe dieses Modells Vorhersagen auf der Basis zweier unterschiedlicher Szenarien, die vom Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) vorgeschlagen wurden. Modell B1 geht von einer raschen Umstellung auf eine weniger produktionsintensive Wirtschaft und von der Einführung sauberer Technologien mit effizienter Ressourcennutzung aus; Modell A1B bleibt deutlich näher am gegenwärtigen Zustand. Aber nach den Vorhersagen beider Szenarien wird die Zahl der Tropennächte in Süd- und Mitteleuropa und selbst in Nordeuropa bis Ende des Jahrhunderts noch weiter zunehmen.
Die Anzahl der Tropennächte mit Temperaturen über 20 °C in Europa in der Vergangenheit und Prognosen für die Zukunft. Die schwarze Kurve beruht auf Zahlen eines Klimasimulationsmodells, die durch direkte Beobachtungen validiert wurden. Die rote und blaue Kurve repräsentieren Vorhersagen des Modells für die Zukunft auf der Basis von zwei Szenarien. Modell B1 (blau): optimistisch – bessere Regulation der Treibhausgasemissionen. Modell A1B (rot): weniger optimistisch – Emissionen eher wie gegenwärtig. Die Kurven geben die durchschnittlichen Ergebnisse von mehreren Modelldurchläufen wieder. Die gesamte Bandbreite der erhaltenen Ergebnisse ist durch den grau schattierten Bereich dargestellt (nach Sillmann und Roekner 2008)
Wie ernst die Auswirkungen auf das menschliche Wohlergehen sein können, veranschaulicht Tab. 14.1. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) kamen beispielsweise in den 1990er-Jahren mehr als 600.000 Menschen weltweit infolge extremer Klimaereignisse ums Leben und mehr als dreimal so viele leiden seither unter schweren gesundheitlichen Problemen. Bei einer Hitzewelle in Chicago im Jahr 1995 waren 514 hitzebedingte Todesfälle und 3300 Aufnahmen in die Notfallambulanzen zu verzeichnen. Für New York wird erwartet, dass die Zahl der zusätzlichen Sterbefälle im Sommer aufgrund des Klimawandels im Jahr 2050 zwischen 500 und 1000 jährlich liegen wird – sofern sich die Bevölkerung an diese Veränderungen anpasst, indem sie zum Beispiel ihr Verhalten oder die städtische Infrastruktur ändert –, und sogar noch höher – sofern eine solche Anpassung ausbleibt (Kalkstein und Greene 1997)
3.3 Globale Infektionsmuster im Wandel
Auch auf Infektionskrankheiten wirken sich die klimatischen Veränderungen aus, und zwar sowohl auf die lokale und globale Verbreitung beim Menschen als auch in ihrer Intensität und Prävalenz. Selbst in wohlhabenden Ländern mit fortschrittlichen hygienischen Verhältnissen wie den Vereinigten Staaten gehen die Todesfälle aufgrund von Lebensmittelvergiftungen jährlich in die Tausende und Klinikaufenthalte in die Hunderttausende. Die Inzidenz nimmt mit der Temperatur erheblich zu, insbesondere oberhalb eines bestimmten Schwellenwerts (Abb. 14.10) – ein Muster, das wahrscheinlich immer häufiger zu beobachten sein wird, wenn die Zahl extremer Klimaereignisse ebenfalls ansteigt.
Die Korrelation zwischen der mittleren monatlichen Maximal- und Minimaltemperatur sowie den Fällen von Dysenterie (Ruhr), verursacht durch Bakterien der Gattung Shigella, in der Stadt Jinan im Nordosten Chinas zwischen 1996 und 2003. Die angepassten Modelle sind signifikant (p < 0,01) (nach Zhang et al. 2007)
Mit größter Wahrscheinlichkeit sind davon Krankheiten wie Malaria betroffen, die von Vektoren übertragen werden, weil diese Vektoren selbst – häufig handelt es sich um Insekten – als ektotherme Organismen (Abschn. 3.1) besonders von der Umgebungstemperatur abhängig sind. Auf diese Organismen wirkt sich nicht nur die Durchschnittstemperatur aus, sondern auch die noch viel unsteteren täglichen und jährlichen Schwankungen. Die Einflüsse des Klimas auf solche Krankheitsüberträger sind sehr komplex – selbst für die wichtigsten sind unsere Kenntnisse der genauen Zusammenhänge noch viel zu rudimentär. Zweifelsohne sollten wir mit Prognosen vorsichtig sein, vor allem, weil frühere Annahmen einer massiven Ausdehnung des Verbreitungsgebiets vielfach durch gemäßigtere Vorhersagen abgelöst wurden, wie beispielsweise für die Malaria in Abb. 14.11. Auf jeden Fall benötigen wir präzisere Vorhersagen, wofür wiederum bessere ökologische Kenntnisse die Voraussetzung bilden.
Die gegenwärtige Verbreitung der durch Plasmodium falciparum verursachten Malaria tropica – der schlimmsten Form der Malaria, die durch Anopheles-Mücken übertragen wird – sowie für das Jahr 2050 vorhergesagte Veränderungen in Regionen der Erde, die für diese Form der Malaria geeignet sind. (Malaria kommt nicht zwangsläufig überall dort vor, wo geeignete Bedingungen herrschen.) Die Vorhersagen beruhen auf einem weit verbreiteten Klimaszenario mit einem 1 %igen jährlichen Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen insgesamt und einer relativ empfindlichen Reaktion des Klimas auf diese Konzentrationen (nach Rogers und Randolph 2000)
3.4 Neu auftretende Infektionskrankheiten
In den letzten Jahren stieg die Zahl neuer Infektionskrankheiten (engl. emerging infectious diseases), die zum ersten Mal in der menschlichen Bevölkerung auftraten oder deren Inzidenz oder Verbreitungsgebiet sich rasch ausdehnte – und zwar weitaus schneller als die Rate der Umweltveränderungen. Am bekanntesten ist sicherlich HIV bzw. Aids, aber auch andere haben hohe öffentliche Aufmerksamkeit erlangt, zum Beispiel das Ebola-Virus, SARS (schweres akutes respiratorisches Syndrom) und Lyme-Borreliose. Die steigende Zahl neu hinzukommender Infektionskrankheiten seit den 1940er-Jahren sowie ihren wahrscheinlichen Ursprung zeigt Abb. 14.12. Bei rund 60 % dieser Krankheiten handelt es sich um Zoonosen (engl. zoonoses), also um Infektionen, die von Natur aus bei nicht menschlichen Wirbeltieren vorkommen und von diesen auf den Menschen übertragen werden können. Ungefähr 70 % dieser Zoonosen stammen von Wildtieren (im Gegensatz zu Haustieren). In manchen Fällen – etwa bei HIV – können sie sich so etablieren, dass sie zu menschlichen Infektionskrankheiten werden. Bei den meisten kommt es allerdings nur selten oder gar nicht zu Übertragungen von Mensch zu Mensch.
Die Zahl der seit den 1940er-Jahren neu aufgetretenen Infektionskrankheiten, danach klassifiziert, ob es sich um Zoonosen handelt oder nicht (nach Jones et al. 2008)
Als Ökologe könnte man sich fragen, wodurch dieser plötzliche Erfolg biologischer Invasionen bedingt ist. Kommt es vermehrt zu Wanderungen? Steigt die Überlebensrate nach einer Wanderung? Handelt es sich um einen neuen Evolutionsschritt? Für all diese Aspekte gibt es Beispiele. Ursache für den Höchststand der neuen Krankheiten in den 1980er-Jahren war die zunehmende Anfälligkeit für Infektionen in Zusammenhang mit der HIV-/Aids-Pandemie. Das Auftauchen der Lyme-Borreliose in den 1960er-Jahren war zurückzuführen auf die verstärkte Wanderung des Pathogens Borrelia burgdorferi infolge veränderter Landnutzung, durch die die Menschen häufiger mit Zecken in Kontakt kamen, welche zuvor bei ihren natürlichen Wirten, Hirschen und Hörnchen, Blut gesaugt hatten. Viele der neu auftretenden und sich ausbreitenden Infektionskrankheiten wurden durch den Einsatz antimikrobieller Wirkstoffe begünstigt, in der Regel Antibiotika, wodurch in der Folge Resistenzen evolvierten. Darauf gehen wir in Exkurs 14.2 noch näher ein.
4 Kunstdünger und die Intensivierung der Landwirtschaft
Das gewaltige Anwachsen der Weltbevölkerung wäre ohne eine ebenso umfangreiche Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion nicht möglich gewesen. Die längste Zeit in der Menschheitsgeschichte – der Mensch evolvierte vor rund 300.000 Jahren – lebten die Menschen als Jäger und Sammler und bezogen ihre Nahrung aus den natürlichen Populationen von Tieren und Pflanzen. Der erste globale Anstieg der menschlichen Bevölkerung erfolgte erst mit der Entwicklung der Landwirtschaft, die vor ungefähr 10.000 Jahren unabhängig voneinander in mehreren Regionen der Erde ihren Ursprung nahm. Der Mensch kultivierte und domestizierte Pflanzen und Tiere und erhöhte durch ständiges Experimentieren über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg deren Produktivität. Dies ermöglichte die Zunahme der menschlichen Bevölkerung.
In den letzten 10.000 Jahren wurde die Weltbevölkerung überwiegend durch die Versorgung mit Nahrung, durch Krankheiten und durch Kriege reguliert. Eine zentrale Rolle nahm dabei die Produktion von Nahrungsmitteln ein, denn Nahrungsknappheit trägt wiederum in hohem Maße zu Krankheiten und Kriegen bei. Eine umfangreichere und verlässlichere Versorgung mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten war für alle Zivilisationen von entscheidender Bedeutung und bildete in der Neuzeit einen wichtigen Schwerpunkt wissenschaftlicher Untersuchungen. Nachdem der deutsche Chemiker Justus von Liebig (Exkurs 11.2) im 19. Jahrhundert entdeckt hatte, dass Stickstoff häufig die landwirtschaftliche Produktivität einschränkt, begann die Suche nach neuen Stickstoffquellen, um eine Steigerung der Produktion zu ermöglichen. Bis ins 20. Jahrhundert stammte der Stickstoff größtenteils aus der Stickstofffixierung durch die bakteriellen Symbionten von Nutzpflanzen wie Luzerne, Klee, Sojabohnen und Erdnüssen, die alle zu den Leguminosen gehören. Durch den Abbau von Guano – in dicken Schichten angehäufte Exkremente von Seevögeln – auf Inseln, etwa vor der Küste von Peru und Chile, erhielt man ebenfalls einen stickstoffreichen Dünger, der vom 18. Jahrhundert bis weit ins 20. Jahrhundert weithin in Gebrauch war.
Die industrielle Produktion von Stickstoffdünger …
Im Jahr 1909 entwickelte der deutsche Chemiker Fritz Haber zusammen mit Carl Bosch, der die Technik zur industriellen Produktion beisteuerte, ein Verfahren zur Herstellung von synthetischem Stickstoffdünger aus dem molekularen Stickstoff (N2) der Luft (Abschn. 12.4). Dieser Kunstdünger macht heute den größten Teil des in der Landwirtschaft verwendeten Stickstoffs aus (Abb. 12.24). Für das Haber-Bosch-Verfahren erhielt Haber 1919 den Nobelpreis für Chemie.
… führte zur Intensivierung der Nutztierhaltung weitab vom Ort des Nutzpflanzenanbaus
Bevor synthetische Stickstoffdünger überall erhältlich waren, war es unabdingbar, den stickstoffreichen Dung aus der Viehhaltung auf die Felder auszubringen. Dieser Dung ist feucht und schwer und daher nur schwierig und unter hohen Kosten zu transportieren. Aus diesem Grund wurde Viehzucht in der Nähe der Felder betrieben oder das Vieh durfte direkt dort auf Weiden grasen. Durch den relativ preisgünstigen Kunstdünger benötigten die Landwirte den tierischen Dung schließlich nicht mehr. Folglich erwies es sich nun als ökonomisch effizienter, die Tiere auf engem Raum in speziellen Mastparzellen, sogenannten Feedlots, zu halten, häufig weit entfernt von den Feldern, und den Dung einfach als Abfall zu entsorgen. Damit wurden die Mastbetriebe zu einer zusätzlichen Quelle der Stickstoffbelastung von Wasser und Luft – gasförmiges Ammoniak verflüchtigt sich in die Atmosphäre –, neben der Stickstoffbelastung durch die Felder, auf denen nun die Futterpflanzen für die Nutztiere angebaut wurden.
In den Vereinigten Staaten begann der Trend zu einer räumlichen Trennung der Nutzpflanzen- und Nutztierproduktion nach dem Zweiten Weltkrieg und beschleunigte sich in den 1950er- und 1960er-Jahren rapide. Das ermöglichte eine Intensivierung der Nutztierhaltung, die wiederum einen enormen Anstieg des Fleischkonsums nach sich zog. In den USA stieg der Fleischkonsum pro Kopf zwischen 1950 und 1970 um 60 % auf etwas über 70 kg im Jahr. Seither ist er ziemlich konstant. Natürlich nahm der Gesamtkonsum aufgrund der wachsenden Bevölkerung weiterhin zu.
Die Intensivierung der Nutztierhaltung dehnte sich weltweit aus
In den letzten Jahrzehnten wurde die Nutztierhaltung in vielen Regionen der Erde intensiviert und es kam zu einer Trennung von Pflanzen- und Tierzucht. Der Pro-Kopf-Fleischkonsum ist weltweit angestiegen, in Lateinamerika sogar so schnell, dass er fast das Niveau der Vereinigten Staaten erreichte (Abb. 14.13a). Wegen der zunehmenden Produktion von Nutztieren müssen natürlich auch mehr Futterpflanzen angebaut werden – unter entsprechendem Einsatz von Düngemitteln. Außerdem brachte die Intensivierung der Nutztierproduktion auch noch Konsequenzen für die menschliche Gesundheit mit sich, beispielsweise die zunehmende Resistenz gegenüber Antibiotika (Exkurs 14.2). Der prozentuale Anteil des Eiweißkonsums in Form von Fleisch steht in engem Zusammenhang mit dem Wohlstand eines Landes (Abb. 14.13b). Wenn der Wohlstand in den Entwicklungsländern weiterhin ansteigt, ist damit zu rechnen, dass auch der Fleischkonsum und die Intensivierung der Nutztierhaltung weiter ansteigen werden.
a Der Pro-Kopf-Fleischkonsum ist in den letzten Jahrzehnten weltweit und in vielen Regionen der Erde angestiegen. In den Vereinigten Staaten blieb er jedoch beständig auf einem hohen, in Südasien und in Afrika südlich der Sahara auf einem niedrigen Niveau. Der weltweite Durchschnitt des Fleischkonsums von heute 43 kg pro Person und Jahr entspricht der Rate in den Vereinigten Staaten im Jahr 1952. b Anteile tierischer Produkte am gesamten Eiweißkonsum des Menschen in den Ländern der Welt im Jahr 2003 in Abhängigkeit vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) (a verändert nach http://www.scopenvironment.org/unesco/USUPB06_LIVESTOCK.pdf, ergänzt um zusätzlichen Daten aus UNEP 2014, b nach Billen et al. 2012)
Exkurs 14.2 Aktueller ÖKOnflikt
Auf die Ernährung kommt es an
Aufgrund der Erkenntnis, dass der Fleischkonsum und die Intensivierung der Nutztierhaltung die Umwelt erheblich schädigen, verabschiedete eine Gruppe von Ökologen und Biogeochemikern 2009 die sogenannte Barsac Declaration. Diese ermahnt alle Menschen auf der Erde dazu, nicht mehr als 35–40 % ihres Eiweißbedarfs über den Konsum von Fleisch zu decken (Billen et al. 2012). Diese „demitarische“ Ernährung (engl. demitarian diet) würde den Fleischkonsum der Bewohner der Vereinigten Staaten und Westeuropas um die Hälfte reduzieren und steht in Einklang damit, was Ärzte als Obergrenze empfehlen. Die Menge entspricht in etwa dem globalen Durchschnitt, wobei es allerdings regionale Unterschiede gibt (Abb. 14.13a). Als Beispiel dafür, wie sich dadurch die Stickstoffbelastung verringern ließe, betrachten wir den Fall von Paris: Wenn sich jeder Einwohner der Stadt auf eine demitarische Ernährung umstellen und überwiegend biologisch erzeugte Nahrung zu sich nehmen würde, könnte die Stickstoffbelastung der Seine um mehr als die Hälfte reduziert werden. Zwar spielt die Einschränkung des Fleischkonsums hierfür eine wesentliche Rolle, es würde jedoch auch schon helfen, anstelle von Nahrungsmitteln, die unter Einsatz von synthetischem Stickstoffdünger angebaut wurden, biologisch erzeugte Produkte zu sich zu nehmen, weil aus biologischem Anbau pro Einheit geernteter Erzeugnisse weniger Stickstoff in Gewässer eingetragen wird (Billen et al. 2012).
Andere Möglichkeiten zur Reduktion der Stickstoffbelastung
Die Stickstoffbelastung aus konventionellem Anbau ließe sich auch schon dadurch erheblich verringern, dass einfach weniger Düngemittel verwendet werden. Im Maisgürtel im oberen Mittleren Westen der Vereinigten Staaten – von wo der überwiegende Teil des in den USA angebauten Maises stammt, die größten Mengen an Stickstoff in den Mississippi gelangen und dadurch die ausgedehnte hypoxische Todeszone im nördlichen Golf von Mexiko entstehen ließen – verwenden die Landwirte regelmäßig mehr Dünger, als ökonomisch sinnvoll ist. Sie würden Geld sparen, wenn sie weniger Dünger kauften und verwendeten, denn ihre Erträge und Bruttoumsätze würden trotzdem gleich hoch bleiben (Abb. 14.14), aber die Belastung des Oberflächenwassers durch Stickstoff ginge zurück. Überschüssiger Stickstoff wird nämlich gar nicht von den Pflanzen aufgenommen und daher leicht ausgewaschen. Warum verschwenden die Landwirte ihr Geld für diese Überdüngung? Der Grund ist offensichtlich, dass die ökonomischen Kosten dafür – sofern man die Schäden an der Umwelt durch die Stickstoffbelastung nicht mit einberechnet – relativ gering sind. Folglich verwenden die Landwirte mehr Dünger in der Hoffnung, dass sie dadurch in einem klimatisch überdurchschnittlich guten Jahr mit optimalen Temperaturen und Niederschlägen vielleicht eine außerordentlich üppige Ernte erzielen können. Sofern die Landwirte auch nur geringfügig weniger synthetische Stickstoffdünger verwenden würden, als für einen maximalen wirtschaftlichen Ertrag empfohlen wird, ließe sich die Stickstoffbelastung unter nur geringen Ernteeinbußen erheblich verringern (Abb. 14.14). Für ihre Ernteverluste zugunsten einer besseren Wasserqualität könnte man den Landwirten eine Entschädigung zahlen.
Die Erträge an Mais und Sojabohnen aus einem durchschnittlichen Landwirtschaftsbetrieb im Maisgürtel der Vereinigten Staaten (blaue Kurve) in Abhängigkeit vom Einsatz von Stickstoffdünger sowie der überschüssige, nicht von den angebauten Pflanzen aufgenommene Dünger, der im Boden verbleibt und ins Oberflächen- und Grundwasser gelangt (breite grüne Kurve). Die Pfeile zeigen an, wie viel Dünger die Landwirte tatsächlich verwenden, wie viel Dünger sie nach Empfehlungen von landwirtschaftlichen Beratungsdiensten für einen maximalen Ertrag verwenden sollten und bei welchen Düngermengen zwar der landwirtschaftliche Ertrag und Profit geringfügig zurückgehen würden, aber auch die Stickstoffbelastung erheblich reduziert würde (nach Howarth et al. 2005)
Agrarwissenschaftler haben noch zahlreiche weitere Möglichkeiten entwickelt, um die Stickstoffbelastung von Gewässern durch die Landwirtschaft zu verringern. Ein Beispiel hierfür ist der Anbau von Wintergetreide wie etwa Roggen als Nebenfrucht im Herbst. Dieses wird dann im Frühjahr geerntet, bevor wieder die ökonomisch wertvolle Hauptfrucht, beispielsweise Mais, angebaut wird. In der gemäßigten Zone sind die Nitratkonzentrationen im Boden im Frühjahr aufgrund der geringen bakteriellen Mineralisierung und der ausbleibenden Assimilation durch Pflanzen über Winter häufig sehr hoch. Dieses Nitrat kann jedoch durch Zwischenfrüchte (engl. cover crops) im zeitigen Frühjahr aufgenommen werden. Ansonsten werden die Nitrate durch die Schneeschmelze und Niederschläge im Frühjahr ausgewaschen und gelangen in die Flüsse. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Boden mit Substanzen zu behandeln, die eine Nitrifikation verhindern (Abb. 11.26). Ammoniumionen binden leichter an Bodenpartikel und werden daher mit erheblich geringerer Wahrscheinlichkeit in Flüsse ausgewaschen als Nitrat. Indem man eine Umwandlung zu Nitrat verhindert, lässt sich die Stickstoffbelastung also ebenfalls reduzieren.
4 Exkurs 14.2 Aktueller ÖKOnflikt
4 Wissenschaftler meinen: Die übermäßige Verwendung von Antibiotika in der Nutztierhaltung stellt eine Gefahr für den Menschen dar
Von Karen McVeigh, The Guardian vom 19. September 2012
Nach Aussage einer Gruppe von Wissenschaftlern, der auch der frühere Leiter der Food and Drug Administration (FDA) [die Lebensmittel- und Arzneimittelzulassungsbehörde der Vereinigten Staaten] angehört, setzt die übermäßige Verwendung von Antibiotika in der Nutztierhaltung und Medizin Menschen einem unnötigen Risiko aus und treibt die Behandlungskosten in die Höhe. Zusammen mit 50 US-amerikanischen Landwirten und Viehzüchtern, die sich dafür entschieden haben, dem Futter ihrer Nutztiere keine nicht therapeutischen Antibiotika mehr zuzusetzen, rufen die Wissenschaftler die FDA und den amerikanischen Kongress dazu auf, gemeinsam den überflüssigen Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung zu regulieren. In am Mittwoch parallel veröffentlichten Stellungnahmen erklärten die Wissenschaftler und Landwirte, eine wachsende Zahl von Untersuchungen habe die Auffassung untermauert, dass die übermäßige Verwendung von Antibiotika in der Nutztierhaltung eine Gesundheitskrise heraufbeschwöre. In einer der Stellungnahmen wurde die Einschätzung einer Studie zitiert, der zufolge alleine Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen Krankenhäusern jährlich Kosten von 20 Mrd. US-Dollar verursachen.
Der frühere FDA-Bevollmächtigte Donald Kennedy, emeritierter Professor der Stanford University, meinte hierzu: „Die routinemäßige nicht therapeutische Beigabe von Antibiotika zu Tierfutter trägt fraglos zur Entwicklung von Antibiotikaresistenzen bei.“ Nicht ausreichend sei, so Kennedy, der derzeitige Ansatz der FDA, die Arzneimittelindustrie solle freiwillig darauf verzichten, für den Menschen medizinisch wichtige Antibiotika als wachstumsfördernde Beigaben zu Tierfutter zu verkaufen. Weiterhin ergänzte Kennedy, der auch acht Jahre lang Chefredakteur der Wissenschaftszeitschrift Science war: „Solange dies nicht gesetzlich geregelt ist, wird es von der Industrie nicht ernstgenommen.“ Drei Jahrzehnte, nachdem sich die FDA darauf festgelegt hatte, dass der Einsatz von Penicillin und Tetracyclin als wachstumsfördernde Beigaben in der Nutztierhaltung eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt, belegten ihre eigenen Daten, dass 80 % aller in den USA verkauften antimikrobiellen Arzneimittel in der Nutztierhaltung verwendet werden.
Die Mikrobiologin Louise Slaughter, Abgeordnete der Demokraten für New York, schloss sich den Wissenschaftlern und anderen an und plädierte ebenfalls dafür, den Einsatz von nicht therapeutischen Antibiotika in der Nutztierhaltung gesetzlich zu regulieren. Auf einer Pressekonferenz, organisiert von der Union of Concerned Scientists [einer Vereinigung von Wissenschaftlern, die sich für Abrüstung und Umweltschutz einsetzen] zur Veröffentlichung der Stellungnahme, zog sie folgenden Vergleich: Die Verwendung der Antibiotika als Zusatz für Tierfutter sei vergleichbar damit, als würden Mütter jeden Morgen Antibiotika über das Müsli ihrer Kinder träufeln. Durch antibiotikaresistente Keime ausgelösten Krankheiten würden heute schon mehr Amerikaner zum Opfer fallen als HIV/Aids, so Slaughter. „Jedes Jahr sterben mehr als 100.000 Amerikaner an bakteriellen Infektionen, die sie sich in Kliniken zuziehen. Die Erreger von 70 % dieser Infektionen sind resistent gegen die Arzneimittel, die normalerweise zu ihrer Behandlung eingesetzt werden. Die unnötige und übermäßige Verwendung muss gestoppt werden.“
Nach Aussagen der Wissenschaftler habe sich zwar die Medizin der Herausforderung gestellt, Ärzte entsprechend ausgebildet und dafür gesorgt, dass weniger Antibiotika verschrieben werden, die Landwirtschaftsindustrie hinke aber noch hinterher. So sei der prinzipielle Zusammenhang von Antibiotikaresistenzen und der Verwendung von Antibiotika zu nicht therapeutischen Zwecken zwar weithin anerkannt, aber dennoch würden Tierfutter routinemäßig große Mengen Antibiotika zugesetzt. Dies geschehe jedoch nicht zur Behandlung von Krankheiten, sondern, um ein schnelleres Wachstum zu fördern und Erkrankungen abzuwenden, die durch mangelhafte Ernährung und die Aufzucht von Tieren unter gedrängten, unhygienischen Bedingungen hervorgerufen werden.
In Wissenschaftskreisen ist schon seit weit über 40 Jahren bekannt, welches Risiko das Verfüttern von Futter mit zugesetzten Antibiotika an Vieh darstellt. Warum wird trotzdem an dieser Praxis festgehalten? Wie könnten Wissenschaftler ihre Besorgtheit effektiver gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik kommunizieren?
5 Monokulturen, Schädlinge und Pestizide in der Landwirtschaft
Was ist ein Schädling?
Einfach ausgedrückt bezeichnet man als Schädling (engl. pest) eine Art, die der Mensch als unerwünscht betrachtet, weil sie ihm entweder direkt Schaden zufügt oder in Konkurrenz mit angebauten Nutzpflanzen tritt. Die Landwirtschaft ist ein auf wirtschaftlichen Gewinn ausgerichteter Industriezweig. Somit kann jede Art als Schädling gelten, die ökonomische Schäden verursacht.
Lautet das Ziel der Schädlingsbekämpfung (engl. pest control) somit, die Schädlinge völlig auszumerzen? In der Regel eigentlich nicht. Vielmehr geht es darum, die Schädlingspopulation auf eine Dichte zu reduzieren, unter der eine weitere Verringerung mehr kosten würde, als man durch erhöhte Erträge an Gewinn erzielen könnte. Man spricht von der ökonomischen bzw. wirtschaftlichen Schadschwelle (engl. economic injury level, EIL). In Abb. 14.15a ist die wirtschaftliche Schadschwelle für einen hypothetischen Schädling veranschaulicht. Sie liegt bei einer Abundanz größer als null, weil eine totale Ausrottung nicht profitabel ist. Aber sie liegt auch unterhalb der durchschnittlichen Abundanz der Art – genau wegen ihrer durchschnittlichen Abundanz wird diese ja zum Schädling. Wäre die Art schon von Natur aus auf eine Dichte unterhalb der wirtschaftlichen Schadschwelle limitiert, wären Bekämpfungsmaßnahmen ökonomisch nicht sinnvoll und die Spezies wäre definitionsgemäß kein Schädling (Abb. 14.15b). Bei manchen Arten liegt zwar die Umweltkapazität (Abschn. 5.5) oberhalb der wirtschaftlichen Schadschwelle, ihre Abundanz wird aber durch ihre natürlichen Feinde in der Regel unterhalb dieser Schwelle gehalten (Abb. 14.15c). Bei diesen Arten handelt es sich dann um potenzielle Schädlinge. Wie wir weiter unten noch sehen werden, können sich diese zu Schädlingen entwickeln, wenn ihre natürlichen Feinde wegfallen.
a Populationsschwankungen einer hypothetischen Schädlingsart. Die Abundanz schwankt um eine Populationsgröße im Gleichgewichtszustand, herbeigeführt durch die Wechselwirkungen des Schädlings mit seiner Nahrung, seinen Feinden usw. Sobald die Abundanz die wirtschaftliche Schadschwelle überschreitet, ist eine Bekämpfung ökonomisch sinnvoll. Um einen Schädling handelt es sich, wenn die Abundanz der Art die meiste Zeit oberhalb der wirtschaftlichen Schadschwelle liegt (sofern sie nicht bekämpft wird). b Dagegen kann eine Art, deren Abundanz stets unterhalb der wirtschaftlichen Schadschwelle schwankt, kein Schädling sein. c Bei potenziellen Schädlingen schwankt die Abundanz normalerweise unterhalb der wirtschaftlichen Schadschwelle, kann diese jedoch überschreiten, wenn einer oder mehrere ihrer natürlichen Feinde wegfallen
Monokulturen verschärfen Probleme durch Schädlinge
Landwirte mussten sich schon immer mit Schädlingen auseinandersetzen, durch die Intensivierung der Landwirtschaft hat sich dieses Problem jedoch verschärft, weil der überwiegende Anteil der Pflanzen für die menschliche Ernährung mittlerweile in Monokulturen (engl. monocultures) angebaut wird – in dichten Populationen aus nur einer Art. Diese ermöglichen es, die Anbaubedingungen für Nahrungspflanzen und Futterpflanzen für Nutztiere so optimal auszurichten, dass sich eine maximale Produktivität erzielen lässt.
Monokulturen begünstigen die Ausbreitung von Krankheiten
Inwieweit sind Monokulturen nachhaltig? Es gibt unzählige Belege dafür, dass sie mit einem hohen Preis einhergehen. So bieten Monokulturen beispielsweise ideale Bedingungen für die epidemische Ausbreitung von Krankheiten wie Schweinepest bei Nutzvieh und Kokzidiose bei Geflügel. Zusätzlich kommt es zu einer hohen Übertragungsrate von Krankheiten zwischen verschiedenen Herden, wenn Tiere von einem Betrieb an einen anderen verkauft werden. Ein anschauliches Beispiel hierfür bildet die dramatische Ausbreitung der Maul- und KIauenseuche bei Vieh in Großbritannien in den Jahren 2001 und 2007.
Auch an Nutzpflanzen lässt sich verdeutlichen, wie fragil die Abhängigkeit des Menschen von Monokulturen ist. Die aus Amerika stammende Kartoffel wurde erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nach Europa eingeführt. Drei Jahrhunderte später hatte sie sich bereits zur fast einzigen Nahrung der armen Bevölkerung Irlands entwickelt. Die dichten Monokulturen boten jedoch ideale Bedingungen für die verheerende Ausbreitung der Kraut- und Knollenfäule (engl. late blight) in den 1840er-Jahren, hervorgerufen durch den damals eingeschleppten pathogenen Pilz Phytophthora infestans. Die Ernteerträge gingen dramatisch zurück und die gelagerten Kartoffeln verfaulten. Etwa 1,1 Mio. Menschen der damaligen irischen Bevölkerung von rund 8 Mio. starben in der dadurch entstandenen Hungersnot und weitere 1,5 Mio. wanderten nach Großbritannien oder in die Vereinigten Staaten aus.
Ende der 1960er-Jahre kam es im Südosten der Vereinigten Staaten zu einem Ausbruch der ebenfalls durch einen Pilz, den Schlauchpilz Helminthosporium maydis (syn. Cochliobolus heterostrophus), hervorgerufenen Maisbleiche (engl. southern corn leaf blight), die sich nach 1970 rasch ausbreitete. Der in diesem Gebiet angebaute Mais stammte überwiegend aus demselben Bestand und war genetisch nahezu einheitlich. Diese extreme Form der Monokultur ermöglichte es einer spezialisierten Rasse des Pathogens, verheerende Schäden anzurichten. Die Verluste durch die Schäden wurden auf mindestens 1 Mrd. Dollar geschätzt und wirkten sich weltweit auf die Getreidepreise aus. Eine der beliebtesten Früchte, die Banane, ist ebenfalls von einer wirtschaftlichen Katastrophe bedroht (Exkurs 14.3).
Exkurs 14.3 Aktueller ÖKOnflikt
Den besten verfügbaren Informationen zufolge muss man davon ausgehen, dass die landwirtschaftliche Produktion weltweit schwere Verluste durch Schädlinge erleidet: Bei Sojabohnen und Weizen belaufen sich die Verluste auf mehr als 25 %, bei Mais auf über 30 %, bei Reis auf 37 % und bei Kartoffeln auf 40 % (Oerke 2006). Zu diesen Verlusten tragen Unkräuter, Schadinsekten und Pathogene bei, wobei Unkräuter für etwa doppelt so hohe Verluste verantwortlich sind wie Schadinsekten und Pathogene zusammen. Auch durch einen erheblich stärkeren Einsatz von Pestiziden in den letzten 40 Jahren konnten – vielleicht überraschenderweise – die Schäden nicht nennenswert eingedämmt werden. Mehr dazu im Folgenden.
5 Exkurs 14.3 Aktueller ÖKOnflikt
5 Ist diese Frucht noch zu retten? Die Banane, wie wir sie kennen, befindet sich auf direktem Weg auszusterben
Im Juni 2005 veröffentlichte Dan Koeppel den folgenden Bericht.Footnote 1
Für nahezu jeden in den USA, in Kanada und in Europa ist Banane gleich Banane: gelb und süß, alle etwa gleich groß, immer bissfest und stets kernlos.
Die Bananensorte Cavendish bildet – laut einem Slogan von Chiquita, dem weltweit größten Bananenproduzenten – „vermutlich die perfekte Nahrung für die Welt“ … Wie sich herausstellte, sind die ca. 1000 Mrd. Cavendish-Bananen, die jährlich weltweit verzehrt werden, auch in genetischer Hinsicht perfekt. Jede einzelne ist eine exakte Kopie der anderen. Ganz gleich, ob sie aus Honduras, Jamaika oder von den Kanarischen Inseln kommt – jede Cavendish-Bananenstaude gleicht einem eineiigen Zwilling der ersten, aus Südostasien stammenden, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einen botanischen Garten in der Karibik gebracht wurde und seit etwa 50 Jahren kommerziell angebaut wird.
Diese Gleichförmigkeit ist das Paradoxe an der Banane. Nach 15.000 Jahren Kultivierung durch den Menschen ist die Banane einfach zu perfekt, sie weist nicht mehr die genetische Variabilität auf, die entscheidend für die Gesundheit einer Art ist. Was eine Bananenstaude krank macht, kann also auch alle anderen krank machen. Wird eine Plantage von einem Pilz befallen oder von einer bakteriellen Erkrankung infiziert, könnten diese ihren Weg um die Welt antreten, Millionen von Stauden zerstören und dafür sorgen, dass die Regale in den Supermärkten leer bleiben.
Ein übertriebenes Szenario? Nicht, wenn man berücksichtigt, dass es bereits einmal eine Bananenapokalypse gegeben hat. Bis Anfang der 1960er-Jahre war die Sorte Gros Michel die Banane in amerikanischen Müslischalen und Eiscremes – eine größere und allen Berichten zufolge besser schmeckende Banane als die, die wir heute verzehren. Wie heute der Cavendish gehörten damals fast alle in Amerika und Europa verkauften Bananen der Sorte Gros Michel – oder Big Mike – an.
Aber Anfang des letzten Jahrhunderts begann sich eine als Panamakrankheit bezeichnete Pilzerkrankung [hervorgerufen durch einen Schlauchpilz der Gattung Fusarium] auszubreiten und die Ernte von Big Mike zu infizieren. Sie tauchte erstmals in Surinam auf, bahnte sich dann ihren Weg durch die Karibik und erreichte schließlich in den 1920er-Jahren Honduras. Im Jahr 1960 waren die Hauptimporteure nahezu bankrott und die Zukunft der Frucht schien in Gefahr.
Nachdem Milliarden von Dollar in die Anpassung der Infrastruktur an die anderen Anforderungen hinsichtlich Wachstum und Reifung geflossen waren, wurde letztendlich die Sorte Cavendish als Ersatz für Big Mike akzeptiert. Sie hatte den Vorteil, gegen die Panamakrankheit resistent zu sein. Allerdings wurde 1992 in Asien eine neue Rasse des Pilzes (Tropical Race 4, TR4) entdeckt, der auch Cavendish befallen kann. Seither hat die von TR4 verursachte Panamakrankheit ganze Plantagen in Indonesien, Malaysia, Australien und Taiwan vernichtet und breitet sich inzwischen in fast ganz Südostasien aus. Noch ist sie nicht nach Afrika oder Lateinamerika übergesprungen, aber die meisten Experten sind sich einig, dass dies irgendwann passieren wird.
Inzwischen sind weltweit Bemühungen im Gang, die Frucht zu retten – charakterisiert durch zwei gegensätzliche Vorstellungen, wie die sich anbahnende Krise am besten bewältigt werden könnte. Die eine Seite verkörpern die traditionellen Bananenzüchter. Sie experimentieren im Anbau mit neuen Züchtungen und versuchen, einen Ersatz zu erschaffen, der so ähnlich aussieht und schmeckt wie die Cavendish, dass die Verbraucher den Unterschied gar nicht bemerken. Die andere Seite bilden Biotechnologen. Ausgerüstet mit dem weitgehend entschlüsselten Bananengenom manipulieren sie die Chromosomen der Pflanzen und kreuzen mitunter DNA anderer Arten ein, mit dem Ziel, einen Abkömmling der Cavendish zu entwickeln, der resistent gegen die Panamakrankheit und andere Krankheiten ist.
Gegenwärtig ist weder eine Möglichkeit in Sicht, die Panamakrankheit effektiv zu bekämpfen, noch ein Ersatz für die Cavendish. So befinden sich die traditionellen Wissenschaftler und die Genetiker in einem Wettlauf – natürlich gegeneinander, aber vor allem gegen die Zeit.
Suchen Sie im Internet nach Optionen, mit denen sich die Bananenindustrie absichern könnte. Wie weit hergeholt erscheint Ihrer Ansicht nach die Gefahr, dass weltweit operierende Wirtschaftsterroristen absichtlich eine Bananenkrankheit in Umlauf bringen könnten?
5.1 Chemische Methoden der Schädlingsbekämpfung
Zum verstärkten Einsatz von Pestiziden (engl. pesticides) – chemischen Substanzen zur Bekämpfung von Schädlingen – kam es in etwa zeitgleich mit der zunehmenden Verwendung von synthetischen Stickstoffdüngern nach dem Zweiten Weltkrieg. Pestizide werden unter anderem unterteilt in Insektizide gegen Insekten, Herbizide gegen Unkräuter und Fungizide gegen Pilze. Als Beispiel dafür, welche Probleme die chemische Schädlingsbekämpfung nach sich ziehen kann, wollen wir hier die Nachhaltigkeit der Bekämpfung von Schadinsekten in der Landwirtschaft betrachten. Ebenso gut hätten wir dazu die Bekämpfung von Unkräutern oder Pilzen als Beispiel heranziehen können.
Mit chemischen Insektiziden sollen an bestimmten Orten zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Schädlingsarten bekämpft werden. Probleme können auftreten, wenn die Insektizide für andere als die Zielarten giftig sind, und vor allem dann, wenn sie sich über die Zielregion hinaus ausbreiten und über den beabsichtigten Zeitraum hinaus in der Umwelt persistieren. Viele Pestizide haben sich zu Umweltschadstoffen entwickelt. Welches Potenzial sie haben, verheerende Katastrophen auszulösen, wurde spätestens beim massiven Einsatz des Insektizids Dieldrin deutlich. Von 1954–1958 wurde Dieldrin großflächig auf Ackerland im US-Bundesstaat Illinois angewendet, um den dort eingeschleppten Japankäfer (Popillia japonica) auszumerzen. Damals wurden Rinder und Schafe vergiftet, 90 % der Katzen auf den Farmen und etliche Hunde wurden getötet und auch zwölf wildlebende Säugetierarten und 19 Vogelarten erlitten erhebliche Verluste (Luckman und Decker 1960).
Pestizide belasten die Umwelt am stärksten, wenn sie unspezifisch wirken, persistieren und sich in Nahrungsketten anreichern
Besondere Probleme haben Insektizide bereitet, die chlororganische Verbindungen (Chlorkohlenwasserstoffe) enthalten, weil diese über die aufgenommene Nahrung biologisch akkumulieren, ein Phänomen, das man als Biomagnifikation (engl. biomagnification) bezeichnet (Abb. 14.16). Dazu kommt es, wenn ein Lebewesen, das ein Pestizid aufgenommen hat, von einem anderen erbeutet wird, dieser Prädator das Pestizid aber nicht metabolisch abbauen oder ausscheiden kann. Dann reichert sich das Pestizid im Körper des Prädators an. Dieser kann dann selbst wieder von einem anderen Prädator gefressen werden und das Insektizid reichert sich bei der Passage durch die Nahrungskette in immer höheren Konzentrationen an. In Spitzenprädatoren, die eigentlich nie als Zielarten vorgesehen waren, können sich die Pestizide auf diese Weise in außerordentlich hoher, bisweilen sogar tödlicher Konzentration ansammeln.
An Land als Pestizide angewendete chlororganische Verbindungen (Chlorkohlenwasserstoffe) gelangen über die Flüsse ins Meer und werden durch die Meeresströmungen und die atmosphärische Zirkulation bis in die Arktis transportiert. Im Rahmen einer Untersuchung in der Barentssee wurde nachgewiesen, wie sich zwei Klassen von Pestiziden während der Passage durch die marine Nahrungskette durch Biomagnifikation anreichern. Im Meerwasser liegen die Pestizide in sehr geringer Konzentration vor. Herbivore Copepoden (Ruderfußkrebse), die sich von Phytoplankton ernähren, enthalten sie in höheren Konzentrationen – gemessen in Nanogramm pro Gramm Fett der Organismen –, prädatorische Amphipoden (Flohkrebse) in noch höheren. Beim Polardorsch (Boreogadus saida), der sich von den Wirbellosen ernährt, und beim Kabeljau (Gadus morhua), der unter anderem auch Polardorsche erbeutet, sind weitere Anzeichen für eine Biomagnifikation erkennbar. Am ausgeprägtesten ist sie allerdings auf den höchsten Stufen der Nahrungskette, denn die Seevögel, die sich von den Fischen ernähren (Gryllteisten, Cepphus grylle) oder von Fischen und anderen Seevögeln (Eismöwen, Larus hyperboreus), können diese Substanzen weitaus weniger gut ausscheiden als Fische oder Wirbellose. Wie zu ersehen, reichert sich Chlordan in geringerem Ausmaß an als polychlorierte Biphenyle (PCB). Das rührt daher, dass Vögel Chlordan besser verstoffwechseln und ausscheiden können (nach Daten aus Borga et al. 2001)
Der Wanderfalke (Falco peregrinus) ist ein sehr markanter, wunderschöner Greifvogel mit nahezu weltweiter Verbreitung. Bis in die 1940er-Jahre brüteten im Osten der Vereinigten Staaten regelmäßig etwa 500 Brutpaare und im Westen und in Mexiko etwa 1000 Paare. Ende der 1940er-Jahre ging ihre Zahl plötzlich rapide zurück. Bis Mitte der 1970er-Jahre war diese Vogelart aus fast allen östlichen US-Bundesstaaten völlig verschwunden und im Westen hatten die Bestände um 80–90 % abgenommen. Ein ähnlich dramatischer Rückgang war auch in Europa zu verzeichnen und der Wanderfalke wurde auf die Rote Liste gefährdeter Arten aufgenommen. Der Bestandsrückgang, der auch viele andere Greifvogelarten betraf, wurde darauf zurückgeführt, dass viele Eier in den Nestern zerbrachen und daher keine normalen Bruten aufgezogen werden konnten.
Als Ursache dafür wurde schließlich die Anreicherung von DDT (Dichlordiphenyltrichlorethan) bei den Elternvögeln erkannt. Dieses Pestizid hatte offenbar Samen und Insekten kontaminiert, welche dann von Kleinvögeln gefressen wurden. In deren Gewebe reicherte sich das DDT an. Die Kleinvögel wurden wiederum von Greifvögeln erbeutet. Bei diesen wirkte sich das Pestizid beeinträchtigend auf die Reproduktion aus: Die Eier der Vögel hatten eine deutlich dünnere Schale und zerbrachen daher viel leichter (Abb. 14.17a).
a Ein Wanderfalke an seinem Brutplatz mit einem Ei und einem frisch geschlüpften Küken (© MIKE READ/naturepl.com/NaturePL). b Die Grafik zeigt die Veränderungen der Eischalendicke von Sperbern (Accipiter nisus) in Großbritannien, gemessen an Museumsexemplaren (nach Ratcliffe 1970)
In den Vereinigten Staaten wurde der Einsatz von DDT 1972 verboten – nicht ganz unschuldig daran war unter anderem Rachel Carsons ein Jahrzehnt zuvor veröffentlichtes Buch Silent spring (Exkurs 14.4). Es wurden Zuchtprogramme für Wanderfalken in Menschenobhut eingerichtet – mit dem Ergebnis, dass mindestens 4000 Wanderfalken wieder ausgewildert werden konnten. Heute brüten Wanderfalken erfolgreich in weiten Teilen der Vereinigten Staaten und gelten nicht mehr als gefährdet. In Großbritannien erholten sich die Bestände sogar so erfolgreich, dass der Wanderfalke von Taubenzüchtern und Liebhabern kleiner Singvögel inzwischen als Schädling betrachtet wird. In einigen Entwicklungsländern fand DDT auch weiterhin als Pestizid in der Landwirtschaft Verwendung, bis es schließlich 2001 durch das Stockholmer Übereinkommen – auch als POP-Konvention bekannt (POP für engl. persistent organic pollutants) – weltweit verboten wurde. Zur Bekämpfung von Insekten, die Krankheiten wie Malaria übertragen, darf es aber nach wie vor angewendet werden.
Die Belastung mit DDT konnte als Ursache für die dünnen Eischalen identifiziert werden, weil in Museen und privaten Sammlungen Exemplare mit genauen Datumsangaben vorlagen. Bei Messungen der Eischalendicke in Sammlungen von Eiern des Sperbers (Accipiter nisus) zeigte sich ein plötzlicher stufenartiger Rückgang um 17 % im Jahr 1947 – also in dem Jahr, in dem erstmals in größerem Umfang DDT in der Landwirtschaft eingesetzt wurde. Nach dem Verbot von DDT nahm die Eischalendicke wieder kontinuierlich zu (Abb. 14.17b).
Wiederanstieg der Schädlingspopulation von Zielarten und Ausbruch von Sekundärschädlingen
In Verruf kommt ein Pestizid, wenn es mehr Arten tötet als diejenige, auf die es eigentlich abzielt – und das ist recht häufig der Fall. Das gilt insbesondere dann, wenn ihm auch die natürlichen Feinde des Schädlings zum Opfer fallen und es somit das Gegenteil dessen bewirkt, was es eigentlich erreichen soll. Sofern ein Pestizid neben der Schädlingsart auch deren natürliche Feinde in großer Zahl abtötet, kann es zu einem Wiederanstieg der Schädlingspopulation (engl. pest resurgence) kommen. In diesem Fall finden Individuen der Schädlingsart, welche die Pestizidbehandlung überlebt haben oder erst anschließend in das Gebiet zugewandert sind, hier eine Fülle an Nahrung vor – und nur wenige natürliche Feinde. Das kann zu einem explosionsartigen Anstieg der Schädlingspopulation führen.
Die Nachwirkungen einer Pestizidbehandlung können aber auch subtiler sein, indem durch das Pestizid beispielsweise die Feinde einer potenziellen Schädlingsart getötet werden, die ansonsten unterhalb ihrer wirtschaftlichen Schadschwelle gehalten wurde. Ihrer natürlichen Regulation beraubt können sich solche Arten nun zu echten, sogenannten Sekundärschädlingen entwickeln (Abb. 14.15c). Zu Beginn der massenhaften Anwendung von organischen Insektiziden im Jahr 1950 gab es an Baumwollpflanzen in Mittelamerika zwei Arten von Primärschädlingen: die Raupe des Eulenfalters Alabama argillacea und den Baumwollkapselkäfer (Anthonomus grandis) (Smith 1998). Weniger als fünfmal im Jahr wurden Insektizide mit chlororganischen Verbindungen (Chlorkohlenwasserstoffe) und Organophosphaten (Phosphorsäureester) angewendet – mit anfangs scheinbar wundersamem Erfolg: Die Erträge schnellten in die Höhe. Bis 1955 waren jedoch drei neue Schädlinge aufgetreten: die Raupe des Baumwollkapselbohrers (Helicoverpa zea), die Gurkenblattlaus (Aphis gossypii) und die Raupe des Eulenfalters Sacadodes pyralis. Daraufhin erhöhten die Farmer die Zahl der Pestizidanwendungen auf acht- bis zehnmal pro Jahr. Zwar konnten dadurch die Blattläuse und die Sacadodes-Raupen eingedämmt werden, aber es traten fünf weitere Sekundärschädlinge auf. In den 1960er-Jahren waren aus den ursprünglich zwei Schädlingsarten acht geworden und es wurden im Schnitt 28 Mal im Jahr Pestizide gespritzt.
Chemische Pestizide verlieren auch dann ihren Wert, wenn die Schädlingsarten, auf die sie abzielen, eine Resistenz entwickeln. Diese Form der natürlichen Selektion in Aktion (Kap. 2) tritt mit ziemlicher Sicherheit dann auf, wenn eine große Zahl von Individuen einer genetisch variablen Population getötet wird. Eines oder wenige Individuen sind möglicherweise ungewöhnlich resistent – weil sie vielleicht ein Enzym besitzen, das in der Lage ist, das Pestizid zu entgiften. Bei wiederholter Anwendung des Pestizids wird jede nachfolgende Schädlingsgeneration einen größeren Anteil resistenter Individuen umfassen. Schädlinge sind in der Regel durch eine hohe potenzielle Reproduktionsrate gekennzeichnet: Aus wenigen Individuen einer Generation können in der nächsten Generation Hunderte oder Tausende Individuen hervorgehen. Auf diese Weise kann sich eine Resistenz sehr rasch in einer Population ausbreiten. Die gleichen Prozesse sind auch am Werk, wenn Bakterien eine Resistenz gegenüber Antibiotika entwickeln – ein Phänomen, dass stark begünstigt wird durch die regelmäßige Beigabe von Antibiotika zu Tierfutter für gesunde Tiere in Massentierhaltungen (Exkurs 14.2).
Evolution von Resistenzen
Über den ersten Fall einer Resistenz gegenüber Insektiziden wurde bereits 1946 berichtet – die Stubenfliege hatte in Schweden eine Resistenz gegen DDT entwickelt. Welches Ausmaß dieses Problem heute angenommen hat, veranschaulicht Abb. 14.19. Resistenzen sind für sämtliche Gruppen von Arthropoden (Gliederfüßer) nachgewiesen, die Schädlinge umfassen, beispielsweise für Fliegen, Käfer, Nachtfalter, Wespen, Flöhe, Läuse und Milben, aber auch für Unkräuter und Pflanzenpathogene. Beispielsweise hat die Raupe des Eulenfalters Alabama argillacea (s.o.), ein Schädling an Baumwolle, in einer oder mehreren Regionen der Erde Resistenzen gegen Aldrin, DDT, Dieldrin, Endrin, Lindan und Toxaphen entwickelt.
Die weltweite Zunahme von Schädlingsarten unter den Arthropoden, die eine Pestizidresistenz entwickelt haben, sowie die Zahl der Pestizidverbindungen, gegen die Resistenzen evolviert sind. Im Schnitt hat jeder Schädling eine Resistenz gegen mehr als ein Pestizid entwickelt, sodass es gegenwärtig mehr als 2500 Fälle einer Resistenzentwicklung gibt (Schädlinge × Verbindungen) (aus der Datenbank für die Pestizidresistenz der Michigan State University, www.pesticideresistance.org/DB/, © Patrick Bills, David Mota-Sanchez und Mark Whalon)
Pestizide funktionieren trotz Resistenzen
Falls chemische Pestizide nur Probleme verursachten, würden sie nicht so weit verbreitet angewendet. Ihre Produktionsrate hat sogar rapide zugenommen. Nach wie vor wiegen für die Landwirte die Kosten für den Kauf und das Spritzen der Pestizide die dadurch verhinderten Ernteverluste auf. Zudem sind in vielen ärmeren Ländern die Aussichten auf eine Hungersnot oder die epidemische Ausbreitung von Krankheiten so beängstigend, dass die Kosten der Pestizidanwendung für die Gesellschaft und die menschliche Gesundheit im Vergleich dazu vernachlässigbar sind. Allein schon objektive Kriterien wie dadurch gerettete Menschenleben, ökonomische Effizienz der Nahrungsmittelproduktion und Gesamtmenge der produzierten Nahrung rechtfertigen in der Regel den Einsatz von Pestiziden. In diesem sehr grundlegenden Sinn kann man ihre Verwendung als nachhaltig bezeichnen. In der Praxis hängt die Nachhaltigkeit davon ab, ob es gelingt, ständig neue Pestizide zu entwickeln, die den Schädlingen immer mindestens einen Schritt voraus sind, die weniger lange in der Umwelt persistieren, biologisch abbaubar sind und spezifischer auf den Zielorganismus wirken.
5.1 Exkurs 14.4 Historische Meilensteine
5.1 Rachel Carson und Der stumme Frühling
Rachel Carson (1907–1964) war eine US-amerikanische Ökologin und Buchautorin (Abb. 14.18). Nach ihrem Masterabschluss in Zoologie war sie gezwungen, ihre Promotion 1935 abzubrechen, um nach dem Tod ihres Vaters ihre Mutter zu unterstützen. Sie nahm eine befristete Stelle im U. S. Bureau of Fisheries an und schrieb das Skript für eine wöchentliche Radiosendung über Meeresökologie. Aufgrund des durchschlagenden Erfolgs dieser Serie erhielt sie 1936 eine unbefristete Anstellung als Meeresbiologin bei der Fischereibehörde – damit war sie erst die zweite Frau, die dort eine derartige Stelle besetzte. Carson behielt ihre Stelle auch nach der Umstrukturierung der Behörde zum U. S. Fish and Wildlife Service nach dem Zweiten Weltkrieg und begann sich 1945 im Rahmen ihrer dortigen Aufgaben, mit den ökologischen Auswirkungen des damals neu freigegebenen Insektizids DDT zu befassen.
Ab 1949 stieg sie zur Chefredakteurin der Publikationen des U. S. Fish and Wildlife Service auf und hatte bis dahin schon mehrere populärwissenschaftliche Artikel über die Natur und Ökologie geschrieben. Da sie ihre Arbeit für die Regierung als langweilig empfand, gab sie ihre Stelle schließlich auf, arbeitete fortan als freie Autorin und veröffentlichte in den folgenden zehn Jahren mehrere Werke, darunter die viel gepriesenen Bücher The sea around us (1950) und The edge of the sea (1955). Diese sind auch heute noch außerordentlich lesenswert.
Carson engagierte sich zunehmend in der Naturschutzbewegung und war ziemlich beunruhigt über den Einsatz von synthetischen chemischen Verbindungen wie DDT in der Natur. Im Jahr 1962 veröffentlichte sie ihr Buch Silent spring – 1963 auf Deutsch unter dem Titel Der stumme Frühling erschienen –, in dem sie das zerstörerische Potenzial der fahrlässigen Verwendung von Pestiziden für natürliche Ökosysteme und die menschliche Gesundheit dokumentierte. Vor der Publikation ersuchte Carson Experten, ihre Kapitel durchzusehen. Von Umweltwissenschaftlern wurde das Werk sehr wohlwollend aufgenommen. Von der chemischen Industrie und mit dieser verbundenen Wissenschaftlern wurden sie und ihr Buch jedoch heftig attackiert.
Silent spring war wirklich bahnbrechend. Es rüttelte die Öffentlichkeit auf, lenkte ihre Aufmerksamkeit auf den Einsatz synthetischer Pestizide und führte letztlich zum Verbot von DDT, zunächst in den Vereinigten Staaten Anfang der 1970er-Jahre und schließlich weltweit im Jahr 2001. Das Buch trug auch zur Entstehung der modernen Umweltbewegung Ende der 1960er-, Anfang der 1970er-Jahre bei. Mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem Tod wurde Carson von Präsident Jimmy Carter posthum die Presidential Medal of Freedom verliehen.
5.2 Biologische Schädlingsbekämpfung
In manchen Fällen ist es Biologen gelungen, die chemischen Verbindungen durch andere Bekämpfungsmethoden zu ersetzen, die die gleiche Aufgabe erfüllen, aber weitaus weniger Kosten verursachen – und zwar sowohl ökonomisch gesehen als auch für die Umwelt. Bei der biologischen Schädlingsbekämpfung (engl. biological pest control) werden die natürlichen Feinde eines Schädlings eingesetzt, um ihn zu bekämpfen. Man unterscheidet drei verschiedene Formen biologischer Schädlingsbekämpfung: Die Einbürgerung natürlicher Feinde, die Förderung der vorhandenen natürlichen Feinde und die integrierte Schädlingsbekämpfung.
Bei der klassischen Form der biologischen Schädlingsbekämpfung wird ein bekannter natürlicher Feind des Schädlings aus einer anderen geografischen Region eingeführt (engl. importation biological control). Zumeist stammt dieser Feind aus dem Herkunftsgebiet der Schädlingsart. Ziel ist es, dass sich der natürliche Feind etabliert und die Schädlingspopulation unterhalb der Schadschwelle hält. Damit liegt hier also eine absichtliche Ansiedlung einer exotischen Art vor – anders ausgedrückt möchte man damit die natürliche Situation zwischen den beiden Arten wiederherstellen.
Ein klassisches Beispiel für diese Form der Schädlingsbekämpfung bildet die Australische Wollschildlaus (Icerya purchasi), die im Jahr 1868 erstmals als Schädling in Zitrusplantagen in Kalifornien entdeckt wurde. Bis 1886 hatte sie es geschafft, die Zitrusindustrie völlig lahmzulegen. Auf der Suche nach natürlichen Feinden der Wollschildlaus stieß man auf zwei Kandidaten, die man aus Australien und Neuseeland einführte. Bei der einen Art handelt es sich um einen Parasitoiden, die Fliege Cryptochaetum iceryae. Diese legt ihre Eier auf den Schildläusen ab und die sich daraus entwickelnden Larven ernähren sich von den Schädlingen. Die zweite Art ist der räuberische Marienkäfer Rodolia cardinalis. Anfangs hatte es den Anschein, als seien die parasitoiden Fliegen nach der Freisetzung völlig verschwunden, während der räuberische Marienkäfer eine explosionsartige Populationsentwicklung durchlief. Erstaunlicherweise hatte man bereits Ende 1890 den gesamten Schildlausbefall in Kalifornien unter Kontrolle. In der Regel wird dieser Erfolg der Einführung des Käfers zugeschrieben. Auf lange Sicht hat sich jedoch gezeigt, dass die Käfer die Schildläuse vor allem im Inland in Schach halten, an der Küste dagegen die Fliege das wichtigste Kontrollelement darstellt (Flint und van den Bosch 1981). In Kalifornien hat sich diese Investition in die biologische Schädlingsbekämpfung wirtschaftlich sehr stark ausgezahlt. Seither wurden diese Marienkäfer in 50 weitere Länder eingeführt.
Biologische Schädlingsbekämpfung durch Förderung natürlicher Feinde
Im Gegensatz dazu steht die zweite Form der biologischen Schädlingsbekämpfung, die darauf abzielt, die Populationsdichte eines von Natur aus bereits in dem Gebiet vorkommenden natürlichen Feindes zu erhöhen (engl. conservation biological control). Zu den natürlichen Feinden der Blattläuse, die als Schädlinge an Weizen gelten, gehören beispielsweise auf Blattläuse spezialisierte Marienkäfer und andere Käfer, räuberische Wanzen, Florfliegen, Schwebfliegenlarven und Spinnen. Viele von ihnen überwintern in den grasbewachsenen Ackerrandstreifen von Weizenfeldern, breiten sich dann von hier in die randnahen Bereiche der Felder aus und dezimieren dort die Blattlauspopulationen. Folglich können Landwirte die Populationen dieser natürlichen Feinde fördern und somit deren Auswirkungen auf die Schädlinge erhöhen, indem sie grasbewachsene Habitate an den Feldrändern erhalten oder sogar innerhalb der Felder Grasstreifen anlegen. Zur biologischen Bekämpfung von Schadinsekten und Unkräutern werden vor allem Insekten eingesetzt.
Bisweilen sind auch Nichtzielorganismen von der Bekämpfung betroffen
Biologische Schädlingsbekämpfung mag auf den ersten Blick als besonders umweltfreundliche Methode erscheinen. Aber selbst bei sorgfältiger Auswahl und scheinbar erfolgreichem Einsatz der verwendeten Feinde kommt es vor, dass auch Nichtzielarten dadurch geschädigt werden (Pearson und Callaway 2003). So wurde beispielsweise in Australien zur Bekämpfung von eingeschleppten Feigenkakteen (Opuntien) die aus Südamerika stammende Kaktusmotte (Cactoblastis cactorum), ein Schmetterling aus der Familie der Zünsler, eingeführt – mit durchschlagendem Erfolg. Als die Kaktusmotte sich jedoch unbeabsichtigt nach Florida ausbreitete, machte sie sich dort über mehrere einheimische Opuntienarten her (Cory und Myers 2000). Der in Nordamerika zur Bekämpfung exotischer Ringdisteln (Carduus sp.) eingeführte, samenfressende Rüsselkäfer Rhinocyllus conicus befällt auch die Samen einiger einheimischer Distelarten und hat zudem negativen Einfluss auf die Populationen der einheimischen Fruchtfliegenart Paracantha culta, die sich ebenfalls von Distelsamen ernährt (Louda et al. 1997). Solche möglichen ökologischen Auswirkungen sollten zukünftig bei der Auswahl potenzieller Nützlinge für eine biologische Schädlingsbekämpfung stärker berücksichtigt werden.
Kombination von chemischer und biologischer Schädlingsbekämpfung
Als integrierte Schädlingsbekämpfung oder auch integrierten Pflanzenschutz (IPS; engl. integrated pest management) bezeichnet man ein Konzept, bei dem verschiedene Formen der Bekämpfung von Schädlingen kombiniert werden: beispielsweise physische Bekämpfung – die Schädlinge einfach von den Nutzpflanzen fernzuhalten –, Bekämpfung durch gezielte Anbaumethoden – etwa durch Fruchtwechsel auf Feldern, sodass die Schädlinge nicht über Jahre hinweg größere Populationen aufbauen können –, biologische und chemische Methoden sowie die Verwendung resistenter Sorten der angebauten Pflanzen. Bei diesem Verfahren muss die wirtschaftliche Schadschwelle genau überwacht werden. Außerdem beruht es großenteils darauf, natürliche Mortalitätsfaktoren wie natürliche Feinde oder das Wetter einzubeziehen und diese so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Breitbandpestizide werden zwar nicht gänzlich abgelehnt, sie werden aber nur sehr sparsam und unter Minimierung der Kosten und verwendeten Mengen eingesetzt. Kein Schädlingsproblem gleicht dem anderen, selbst auf benachbarten Feldern nicht. Deshalb ist es ganz wesentlich für eine integrierte Schädlingsbekämpfung, die Bekämpfungsmaßnahmen spezifisch auf das Problem abzustimmen.
Integrierte Bekämpfung der Kartoffelmotte
Die Raupen der Kartoffelmotte (Phthorimaea operculella) sind ein häufiger Schädling im Kartoffelanbau in Neuseeland. Als Zuwanderer aus warmen, subtropischen Regionen verursacht die Kartoffelmotte bei warmem, trockenem Wetter die verheerendsten Schäden. Pro Jahr können sechs bis acht Generationen auftreten. Die Raupen der verschiedenen Generationen minieren in unterschiedlichen Pflanzenteilen wie Blättern, Sprossen und Knollen. Da die Raupen in den Knollen sowohl vor ihren natürlichen Feinden als auch vor Insektiziden sicher sind, muss die Bekämpfung bei den Generationen ansetzen, die an Blättern minieren. Die integrierte Bekämpfungsmethode für die Kartoffelmotte umfasst die Bestandsüberwachung mittels Pheromonfallen, durch gezielte Bodenbearbeitung sowie den Einsatz von Insektiziden – dies allerdings nur, wenn es absolut erforderlich ist (Herman 2000). Die Kartoffelbauern orientieren sich dabei an dem in Abb. 14.20 dargestellten Entscheidungsbaum.
Entscheidungsbaum für die integrierte Bekämpfung der Kartoffelmotte (Phthorimaea operculella) in Neuseeland. Die Fragen in den Kästen (beispielsweise „Wachstumsphase der Pflanzen?“) müssen die Kartoffelbauern beantworten und entsprechend der Antworten in den Pfeilen (beispielsweise „vor der Knollenbildung“) ist in den vertikalen Kästen die empfohlene Vorgehensweise angegeben (z.B. „kein Insektizideinsatz“). Man beachte, dass in Neuseeland im Februar Spätsommer herrscht (nach Herman 2000; Foto: © Graphic Science/Alamy)
6 Globaler Flächenverbrauch und andere Einschränkungenfür eine weitere Intensivierung der Landwirtschaft
In den Jahrzehnten zwischen 1961 und 2008 hat sich die landwirtschaftliche Produktion von Nutzpflanzen weltweit verdreifacht, allerdings haben die Anbauflächen in diesem Zeitraum nur um 10 % zugenommen (Abb. 14.21a). Diese Statistik verschleiert einige wesentliche regionale Unterschiede: In Osteuropa und Russland sind die Anbauflächen weniger geworden, in geringerem Umfang auch in den Vereinigten Staaten, während in Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Afrika die ackerbaulich genutzten Flächen jeweils zugenommen haben. Dank des hohen Bevölkerungswachstums ist die ackerbaulich genutzte Fläche pro Kopf global gesehen um 50 % zurückgegangen (Abb. 14.21b). Auslöser für die Zunahme der Nahrungsmittelproduktion war die Intensivierung der Landwirtschaft, vor allem der Einsatz von Stickstoffdüngern. Hinzu kamen weitere Faktoren wie die zunehmende Nutzung fossiler Treibstoffe für den Betrieb von Traktoren und Mähdreschern, erweiterte Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, eine umfassende Bewässerung sowie die Züchtung ertragreicherer Sorten der angebauten Pflanzen. Lässt sich die Produktion noch weiter steigern?
a Zunahme der globalen Produktion von Nutzpflanzen und der ackerbaulich genutzten Fläche seit 1961, dargestellt im Verhältnis zu den Werten von 1961 (nach UNEP 2014). b Veränderungen der Weltbevölkerung, des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch, des Pro-Kopf-Konsums an Nahrung insgesamt, des Pro-Kopf-Konsums pflanzlicher Lebensmittel und der pro Kopf ackerbaulich genutzten Fläche seit 1961, ebenfalls dargestellt im Verhältnis zu den Werten von 1961 (nach Bringezu et al. 2009)
Wasser ist eine endliche globale Ressource
Eine Einschränkung stellt die Verfügbarkeit von Wasser dar. Global betrachtet ist die Landwirtschaft der größte Verbraucher von Trinkwasser: Sie verbraucht 70 % der verfügbaren Menge. Eine Bewässerung ist vor allem in Entwicklungsländern unabdingbar. So kommt es, dass in manchen Regionen Südamerikas, Zentralasiens und Afrikas mehr als 90 % des verfügbaren Süßwassers in der Landwirtschaft verbraucht werden. Schon heute trocknen der Nil in Afrika, der Gelbe Fluss (Huang He) in China und der Colorado River in Nordamerika zumindest zu bestimmten Zeiten des Jahres aus – mit verheerenden Folgen für die stromabwärts gelegenen Küstengewässer. Es gibt eindeutig Grenzen, wie viel Wasser wir über die derzeitige Menge hinaus zur Bewässerung verwenden können. Mit ziemlicher Sicherheit wird der globale Klimawandel die Probleme der Wasserversorgung und des Wasserverbrauchs noch weiter verschärfen, weil künftig viele Regionen der Erde nicht nur wärmer, sondern auch trockener werden (Abb. 14.22).
Vorhersagen zu den Veränderungen der Niederschläge im Zeitraum von 2090–2099 im Vergleich zur Situation Ende des 20. Jahrhunderts, beruhend auf Ergebnissen zahlreicher globaler Modelle. Bei den weißen Flächen bestand weniger als 66 % Übereinstimmung zwischen den Modellen, bei den gepunktete Regionen mehr als 90 % (aus IPCC 2007)
Die Degradation von Böden stellt eine weitere Einschränkung für die Landwirtschaft dar
Rund 300 Mio. ha Boden sind heute so stark degradiert, dass auf ihnen aufgrund der Erschöpfung der Nährstoffe, der Anreicherung von Salzen oder anderer Probleme keine produktive Landwirtschaft mehr erfolgen kann. Weitere 1,2 Mrd. ha – das entspricht 10 % der von Pflanzen bewachsenen Erdoberfläche – sind als leicht degradiert einzustufen. Auf Flächen ohne Boden können nur sehr kleine, primitive Organismen wie Flechten und Moose leben, denen nackter Fels als Untergrund ausreicht. Die übrige terrestrische Vegetation der Erde benötigt Boden für ihre Wurzeln. Er gibt den Pflanzen physischen Halt und versorgt sie während des Wachstums über die Wurzeln mit essenziellen mineralischen Nährstoffen und Wasser. Böden entwickeln sich durch Akkumulation kleinster mineralischer Partikel, die bei der Verwitterung von Gestein entstehen, und aus organischen Abbauprodukten früherer Vegetation. Boden kann durch Erosion abgetragen werden – weggewaschen durch Regen oder weggeweht durch den Wind. Er kann aber auch an anderen Stellen in Form von fein strukturiertem Löß wieder abgelagert werden. Am besten vor Abtragung geschützt sind Böden, wenn sie organisches Material enthalten, stets ganz von Vegetation bedeckt sind, feinmaschig von Wurzeln und Wurzelhärchen durchzogen sind und wenn sie sich auf horizontalem Untergrund befinden. Die Umwandlung von natürlichen Ökosystemen in Ackerland bringt in der Regel immer eine gewisse Degradation der Böden mit sich. Dramatische Belege für eine nicht nachhaltige Landnutzung sind verheerende Ereignisse wie die sogenannte Staubschüssel (engl. dust bowl) in den Great Plains in den Vereinigten Staaten und eine ähnliche Katastrophe, die sich gerade in China abspielt (Exkurs 14.5).
Wüstenbildung und Versalzung
Besonders anfällig für eine Degradation sind landwirtschaftlich genutzte Flächen in ariden und semiariden Regionen. Durch Überweidung und intensiven Anbau ist der Boden direkt der Erosion durch Wind und die seltenen, aber heftigen Regenfälle ausgesetzt. Von Desertifikation oder Wüstenbildung (engl. desertification) spricht man, wenn Flächen in ariden oder semiariden Regionen mit ehemals natürlichen Ökosystemen für Subsistenzwirtschaft oder von Nomaden landwirtschaftlich genutzt werden und sich nach und nach in Wüste verwandeln. Durch Bewässerungsmaßnahmen lässt sich dieser Prozess vorübergehend verlangsamen. Allerdings sinkt dadurch auch der Grundwasserspiegel und in der oberen Bodenschicht können sich Salze anreichern. Diese Versalzung (engl. salinization) erschwert eine dauerhafte Nutzung der Böden für die Landwirtschaft massiv. In den meisten Fällen breitet sich eine solche Versalzung aus und führt dazu, dass sich sterile weiße Salzwüsten ausdehnen. Besondere Versalzungsgefahr bestand in den bewässerten Gegenden Pakistans und einigen weiteren asiatischen Ländern, die ehemals der Sowjetunion angehörten.
Der Trend zu einer erhöhten landwirtschaftlichen Produktivität verringert sich
Obwohl die Produktivität pro Flächeneinheit bei vielen wichtigen angebauten Nutzpflanzen global gesehen weiter zunimmt, verringert sich der Produktivitätsanstieg für alle Nutzpflanzen, bei manchen bleibt er auch gleich (Abb. 14.24a). Sofern die gegenwärtigen Trends anhalten, könnte es innerhalb der nächsten Jahrzehnte dazu kommen, dass auf der gleichen Fläche Land nicht mehr noch größere Mengen an Nutzpflanzen angebaut werden können – zumindest global betrachtet. Für einige Nutzpflanzen besteht in manchen Regionen noch Raum für eine höhere Produktivität, etwa für Mais in Brasilien, Mexiko und Indien oder für Ölpalmen in vielen Ländern, vor allem Nigeria (Abb. 14.24b). Global gesehen haben wir jedoch offenbar die Grenzen des Möglichen erreicht, was unter anderem an den Einschränkungen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Wasser sowie Klimaschwankungen liegt. Tatsächlich sind Wissenschaftler besorgt darüber, dass die landwirtschaftliche Produktivität aufgrund des globalen Klimawandels zurückgehen wird. Es gibt bereits Belege dafür, dass die Luftverschmutzung jetzt schon die Produktion von Nutzpflanzen einschränkt. Neueren Modellen zufolge senkt das gegenwärtige Ausmaß der Ozonbelastung – überwiegend durch Emissionen von Stickstoff, Methan und Kohlenwasserstoffen bei der Erzeugung und Verwendung fossiler Brennstoffe (Abschn. 12.4) – schon aktuell die globale Produktion von Grundnahrungsmitteln wie Weizen (um 3,9–15 %), Sojabohnen (um 8,4–14 %) und Mais (um 2,2–5,5 %). Sollte die gegenwärtige Entwicklung der Luftverschmutzung anhalten, könnte dieser negative Effekt die Nutzpflanzenproduktion in den kommenden Jahrzehnten noch erheblich weiter verringern (Avnerya et al. 2011).
a Globale Entwicklung der Ernteerträge verschiedener wichtiger Nutzpflanzen seit 1960. Ein Wert von 0 % zeigt keine Änderung der Erträge an. b Tatsächliche Erträge und potenzielle Maximalerträge vier wichtiger Nutzpflanzen. Für jede dieser Pflanzen sind jeweils sechs der wichtigsten Anbauländer dargestellt (aus UNEP 2014)
Für einen weiteren Anstieg der globalen Nutzpflanzenproduktion ist wahrscheinlich mehr Land erforderlich
Für einen weiteren Anstieg der globalen Nutzpflanzenproduktion ist demnach wahrscheinlich mehr Land erforderlich. Aber wie viel mehr? Als wir dies schrieben, brachten die Vereinten Nationen gerade neue Schätzungen heraus: Diesen zufolge werden bis zum Jahr 2050 weitere 70–300 Mio. ha Land benötigt werden (Tab. 14.2) – das entspricht einer Zunahme von bis zu 20 % gegenüber den derzeit ackerbaulich genutzten 1530 Mio. ha (UNEP 2014). Durch das Wachstum der Städte und ihrer Randbezirke werden jedoch107–129 Mio. ha verloren gehen, so die Vorhersagen, und aufgrund der fortschreitenden Bodendegradation müssen vermutlich bis 2050 zwischen 90 und 225 Mio. ha an Ackerflächen aufgegeben werden. Darüber hinaus verfolgen zahlreiche Länder eine aggressive Politik zum Anbau von nachwachsenden Rohstoffen für die Herstellung von Biokraftstoffen als Energiequelle. Um die gesetzten Ziele zu erreichen und weil die Landwirtschaft auch für die Industrie nachwachsende Rohstoffe produzieren muss – beispielsweise für biologisch abbaubare Teller und Gabeln aus Maismehl –, werden schätzungsweise weitere 52–195 Mio. ha Land erforderlich sein (UNEP 2014). Addiert man diesen potenziellen Bedarf, so ergibt sich, dass bis 2050 bis zu 859 Mio. ha neuer Anbauflächen nötig sein könnten (Tab. 14.2). Das entspricht einer Zunahme der gegenwärtig weltweit ackerbaulich genutzten Fläche von mehr als 50 %.
Die Herstellung flüssiger Biokraftstoffe ist vielleicht keine so gute Idee
Biokraftstoffe (engl. biofuels) sind Energiequellen aus Biomasse, die entweder in der Landwirtschaft produziert oder aus natürlichen Ökosystemen entnommen wird. Bei flüssigen Biokraftstoffen (engl. liquid biofuels) handelt es sich Substanzen, die Benzin oder Diesel ersetzen können, wie beispielsweise Ethanol oder Kohlenwasserstoffe. Vielen erschien der Anbau von Pflanzen für die Herstellung von flüssigen Biokraftstoffen eine Win-win-Situation zu sein. Folglich ist die Produktion flüssiger Biokraftstoffe im letzten Jahrzehnt global explosionsartig angestiegen, insbesondere die Herstellung von Ethanol (Abb. 14.25). Den größten Anteil an diesem Produktionsanstieg hatten die Vereinigten Staaten, vor allem durch die gewaltige Zunahme der Ethanolherstellung aus Mais.
Globale Produktion von Ethanol und Biodiesel von 1975–2007 (aus Howarth und Bringezu 2009)
Vielleicht war diese Vision zu schön, um wahr zu sein. Im Jahr 2010 wandte sich der Council of Scientific Society Presidents, ein Dachverband der 1,4 Mio. Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten, in einem Brief an den amerikanischen Präsidenten. Darin erklärte der Verband, es sei zwar äußerst dringlich, das Problem der globalen Erwärmung in Angriff zu nehmen, aber einige der vermeintlichen Lösungen hierfür seien nicht eingehend genug wissenschaftlich überprüft worden. Hingewiesen wurde speziell auf die Produktion flüssiger Biokraftstoffe aus Mais und die Erschließung von Erdgas aus Schiefergestein durch Fracking (Exkurs 12.2). Beide Lösungen erscheinen oberflächlich betrachtet sinnvoll und könnten politisch gesehen funktionieren – aber mit möglicherweise gravierenden Folgen für die Umwelt, welche die globale Erwärmung eher noch verschlimmern als reduzieren.
Ethanol näher betrachtet
Biokraftstoffe machen 13 % der weltweiten Energieversorgung aus, aber nur weniger als 1 % davon entfallen auf flüssige Biokraftstoffe. Beim globalen Verbrauch an Biomasse dominiert die Verbrennung fester Formen wie Holz und tierische Abfälle – durch getrockneten Dung werden bis zu 5 % des globalen Energieverbrauchs gedeckt. Praktisch das gesamte Ethanol weltweit wird heute aus Nutzpflanzen hergestellt, die auch der Ernährung dienen können. Die global gesehen größte Quelle stellt Mais aus den Vereinigten Staaten, gefolgt von Zuckerrohr aus Brasilien. Im Jahr 2007 wurden in den USA 24 % der Maisernte für die Herstellung von 1,3 % der gesamten Versorgung des Landes mit Flüssigkraftstoffen verwendet (der Rest verteilt sich auf Benzin, Diesel und andere Produkte aus Erdöl). Seither ist die Ethanolproduktion noch weiter angestiegen. 2012 wurden dafür 40 % der Maisernte in den USA verbraucht, aber nach wie vor wird daraus nur ein sehr kleiner Prozentsatz der im Land benötigten Energie produziert.
Der Prozess zur Herstellung von Ethanol aus solchen Nutzpflanzen ist grundsätzlich ineffizient, das gilt insbesondere für Mais. Der Anbau von Mais ist selbst sehr energieaufwendig. Die Hälfte des Energiegehalts der Ernte geht während der Fermentation (Gärung) zu Ethanol verloren. Für die Destillation des Ethanols zu einer wasserfreien Form, die mit Benzin gemischt werden kann, werden große Mengen an Energie aus Steinkohle oder Erdgas benötigt. Pro Flächeneinheit Land ließe sich neunmal mehr Energie erzeugen, wenn man darauf stattdessen mehrjährige Gräser anbauen und diese dann zur gleichzeitigen Produktion von Wärme und Elektrizität verbrennen würde. Angesichts des weltweit drohenden Mangels an Flächen für die Landwirtschaft ist der Bedarf an Land allerdings ein ganz entscheidender Punkt.
Die Luftverschmutzung durch die Nutzung von Ethanol ist stärker als die durch Benzin und bringt auch einer stärkere Verschmutzung der Gewässer mit sich – in Brasilien sind Abwässer aus der Fermentation dafür verantwortlich, in den Vereinigten Staaten der Anbau von Mais. Die nationale Politik in den USA sieht vor, den Austrag von Stickstoff über den Mississippi um 45 % zu reduzieren und dadurch die Todeszone im nördlichen Golf von Mexiko zu verkleinern (Exkurs 1.4 und Kap. 11). Allerdings gelangen mehrere Untersuchungen zu dem Schluss, dass durch die nationale Politik, mehr Ethanol aus Mais herzustellen, diese Stickstoffbelastung sogar noch um mindestens 30 % zunehmen wird.
Als Kraftstoff verwendet könnte Ethanol auch die Emissionen von Treibhausgasen stärker verschlimmern als fossile Brennstoffe. Auf jeden Fall hinterlässt es bezüglich der Treibhausgasemissionen einen größeren ökologischen Fußabdruck als erneuerbare Energiequellen wie Wind und Sonnenenergie. Hinzu kommen noch umfangreiche indirekte Folgen hinsichtlich des Flächenverbrauchs, die zu einem deutlichen Anstieg der Treibhausgasemissionen führen könnten (Searchinger et al. 2008). Je größer der Anteil der Maisernte in den USA, der zur Herstellung von Ethanol verwendet wird, desto weniger Mais steht als Nahrung für den Menschen oder Viehfutter zur Verfügung. Infolgedessen ist der Bedarf gestiegen, Tierfutter andernorts anzubauen. Betroffen davon ist vor allem der Anbau von Sojabohnen in der Cerrado-Region, einem ausgedehnten tropischen Savannengebiet in Brasilien (Kap. 4). Das hat wiederum zur Folge, dass die wenig intensive Weidewirtschaft mit Fleischrindern der Cerrado-Region zum Teil in das Amazonasgebiet verlagert wurde, wo für das Anlegen des Weidelands Regenwald abgeholzt wird (Abb. 14.26). Weideland für Rinder zu schaffen, ist eine der Hauptursachen für die Entwaldung im Amazonasgebiet und die Abholzung tropischer Wälder ist eine der bedeutendsten Quellen für den Eintrag von Kohlendioxid in die Atmosphäre (Abb. 12.8). Um nachvollziehen zu können, welche Folgen lokales Handeln für die Umwelt hat, bedarf es mehr denn je einer globalen Betrachtung.
Ein Beispiel für die indirekten Folgen der Herstellung von Ethanol aus Mais hinsichtlich des Flächenverbrauchs. Je mehr Mais in den Vereinigten Staaten für die Ethanolherstellung verwendet wird, desto stärker nimmt der Anbau von Sojabohnen in der Cerrado-Region in Brasilien für die Produktion von Tierfutter zu, das ursprünglich aus Mais erzeugt wurde. Der expandierende Sojabohnenanbau verdrängte die wenig intensive Weidewirtschaft mit Rindern. Diese hat sich nun stattdessen ins Amazonasgebiet verlagert, wo zur Schaffung von neuem Weideland Wälder abgeholzt werden (links: © Purdue9394/istockphoto.com, Mitte: © Andre Penner/ASSOCIATED PRESS/picture alliance, rechts: © Ron Haviv/VII/Corbis)
6 Exkurs 14.5 Historische Meilensteine
6 Bodenerosion: die historische Staubschüssel in den Vereinigten Staaten und die Probleme im heutigen China
Einst wurden weite Teile der USA, etwa im Südwesten von Colorado, im Südwesten von Kansas, Teile von Texas und Oklahoma sowie der Nordosten von New Mexico, als Weideland für Viehherden genutzt. Die natürliche Vegetation bestand hier weitgehend aus mehrjährigen einheimischen Gräsern und die Flächen waren zuvor noch nie ackerbaulich genutzt worden.
Während des Ersten Weltkriegs wurde jedoch ein Großteil dieser Flächen landwirtschaftlich erschlossen und für den Anbau von einjährigem Weizen umgepflügt. Aufgrund heftiger Dürren fielen die Erträge Anfang der 1930er-Jahre nur spärlich aus und der exponierte Oberboden wurde vom Wind abgetragen. Die dabei entstandenen Staubstürme verdunkelten die Sonne und führten zu beträchtlichen Verwehungen (Abb. 14.23a). Bisweilen fegten die Staubstürme durch das ganze Land bis an die Ostküste. Auf dem Höhepunkt der als Great Depression bezeichneten Wirtschaftskrise zu Beginn und Mitte der 1930er-Jahre mussten Tausende von Familien gezwungenermaßen die Region verlassen. Mithilfe staatlicher Unterstützung konnte die Winderosion nach und nach aufgehalten werden. Es wurden Grüngürtel als Windschutz gepflanzt und das ursprüngliche Grasland in weiten Teilen wiederhergestellt. Anfang der 1940er-Jahre hatte sich die Region wieder weitgehend erholt.
Diese Geschichte wiederholt sich derzeit gerade im Nordwesten von China. Hier hat die Notwendigkeit, 1,3 Mrd. Menschen ernähren zu müssen, dazu geführt, dass zu viele Rinder und Schafe gehalten werden und der Boden zu stark umgepflügt wird. Infolgedessen wandeln sich alljährlich rund 2300 km² Fläche in Wüsten um. Im Jahr 2011 hüllte ein gewaltiger Staubsturm (Abb. 14.23) nicht nur den Osten Chinas ein, sondern auch weite Teile im Westen Nordamerikas.
7 Nahrungsversorgung durch Fischerei und Aquakultur
Es besteht ein wesentlicher Unterschied darin, ob die Nahrungsversorgung durch Viehzucht oder durch Fischerei erfolgt. Landwirtschaftsbetriebe und Viehherden sind zumeist im Besitz eines Landwirts oder einer Organisation und werden von diesen verwaltet. Im Gegensatz dazu waren die meisten marinen Gewässer, in denen Fischfang betrieben wird, einst Allgemeinbesitz. Das hat quasi jedem Tür und Tor geöffnet, sie auf potenziell nicht nachhaltige Weise zu plündern. Im Laufe der letzten 50 Jahre wurde der Fischfang die durch nationale und internationale Gesetzgebung zunehmend reguliert und es wurden nationale Besitzansprüche geltend gemacht. Das hat jedoch nicht zwangsläufig zu einem angemessenen Umgang mit diesen Ressourcen geführt, wie wir noch sehen werden. Die weltweit gefangene Menge an Wildfisch ist in den letzten 25 Jahren die meiste Zeit konstant geblieben und im letzten Jahrzehnt vielleicht sogar etwas zurückgegangen (Abb. 14.27). Gleichzeitig haben Aquakulturen zur kontrollieren Aufzucht von Speisefischen zugenommen.
Der schmale Grat zwischen Über- und Unternutzung
Immer wenn eine natürliche Population vom Menschen ausgebeutet wird, besteht die Gefahr der Übernutzung (engl. overexploitation): Durch die Entnahme zu vieler Individuen gerät die Population biologisch in Gefahr oder in wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit – bisweilen kann das sogar bis zur völligen Ausrottung gehen. Die Fangmenge an Meeresfischen stieg von 1950–1989 weltweit um das Fünffache an. Bei vielen Speisefischbeständen ist die Schwelle zur Übernutzung bzw. Überfischung mittlerweile überschritten (Abb. 14.28). Den Nutzern ist aber auch daran gelegen, eine Unternutzung (engl. underexpoloitation) zu vermeiden – wenn weniger Individuen entnommen werden, als für den Erhalt der Population erforderlich ist, fallen die Erträge unnötigerweise geringer aus. Es bleibt weniger für potenzielle Konsumenten und die Nutzer sind unterbeschäftigt. Auf dem schmalen Grat zwischen Unter- und Übernutzung zu wandeln, ist nicht einfach. Es ist großes Geschick gefragt, um allem gerecht zu werden: dem Wohlergehen der Bestände der genutzten Arten, der Profitabilität der Unternehmen, der dauerhaften Erhaltung von Arbeitsplätzen, der Aufrechterhaltung traditioneller Lebensweisen, gesellschaftlichen Gepflogenheiten und der natürlichen Biodiversität.
Veränderungen der Anteile an der globalen Meeresfischproduktion von Fischbeständen in unterschiedlichen Phasen der Ausbeutung. In den 1950er-Jahren entfielen die meisten Fänge auf nur schwach erschlossene Fischbestände, im Jahr 2000 wurden die meisten schon in vollem Umfang genutzt (nahe am höchstmöglichen Dauerertrag), bereits übernutzt oder waren sogar schon zusammengebrochen (nach Khan et al. 2006)
Populationsdynamik ohne Ausbeutung – Optimumkurven der Nettowachstumsrate
Um herauszufinden, welche Form der Nutzung für eine Population am besten geeignet ist, müssen wir die Konsequenzen der verschiedenen Ausbeutungsstrategien kennen. Dazu ist es jedoch erforderlich, die Populationsdynamik ohne bzw. vor der Ausbeutung zu verstehen. Zunächst wird angenommen, dass eine zum Fang vorgesehene Population vor Beginn der Nutzung eine hohe Populationsdichte aufweist und eine starke intraspezifische Konkurrenz herrscht. Diese sehr verallgemeinernde Annahme beruht auf Erkenntnissen aus Abschn. 5.5:
-
Es ist zu erwarten, dass sich Populationen, die nicht ausgebeutet werden, im Bereich ihrer Umweltkapazität einpendeln; durch eine Nutzung geht die Individuenzahl unter diese Kapazität zurück.
-
Durch Ausbeutung einer Population verringert sich die Intensität der intraspezifischen Konkurrenz. Dadurch verschiebt sich die Populationsgröße entlang der buckelförmigen Optimumkurve für die Nettowachstumsrate nach links – die Nettowachstumsrate der Population pro Zeiteinheit erhöht sich also (Abb. 14.29).
Die Korrelation zwischen der Nettowachstumsrate einer Population (Geburten minus Sterbefälle) und der Größe der Population ergibt infolge der Effekte intraspezifischer Konkurrenz eine Optimumkurve (Kap. 5). Die Populationsgröße nimmt von links nach rechts zu, bei zunehmender Ausbeutung verschiebt sich das Verhältnis dagegen von rechts nach links
Der höchstmögliche Dauerertrag – der richtige Weg?
Wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen, denn anhand des Verlaufs der Kurve in Abb. 14.29 wird deutlich, dass es eine mittlere Populationsgröße geben muss, bei der die Nettowachstumsrate der Population am höchsten ist. Nehmen wir als zeitliche Skala Jahre an. Der Gipfel der Kurve könnte bei einer Nettowachstumsrate von 10 Mio. neuen Fischen pro Jahr liegen. Dies entspricht der höchsten Zahl an Fischen, die der Population regelmäßig jedes Jahr auf unbegrenzte Zeit entnommen und von dieser selbst wieder ersetzt werden könnten. Dies bezeichnet man als den höchstmöglichen Dauerertrag oder auch maximalen nachhaltigen Ertrag (engl. maximum sustainable yield, MSY). Wenn es gelänge, beim Fischfang genau diesen maximalen Dauerertrag zu erzielen, könnte der schmale Grat zwischen Unter- und Übernutzung wahrscheinlich beschritten werden.
Das Konzept des höchstmöglichen Dauerertrags weist Mängel auf
Das Konzept des maximalen Dauerertrags diente viele Jahre lang für das Ressourcenmanagement im Fischereiwesen und auch in der Forstwirtschaft sowie bei der Nutzung von Wildbeständen durch Bejagung als Leitprinzip. Aus mehreren Gründen stellt es allerdings alles andere als eine perfekte Lösung dar.
-
Da eine Population ganz einfach als Anzahl ähnlicher Individuen betrachtet wird, bleiben sämtliche Aspekte der Populationsstruktur wie Größen- oder Altersklassen und deren unterschiedliche Wachstums-, Überlebens- und Reproduktionsraten unberücksichtigt.
-
Da das Konzept auf nur einer einzigen Wachstumskurve beruht, wird die Variabilität der Umwelt ausgeklammert.
-
In der Praxis ist es mitunter unmöglich, verlässliche Schätzungen für den höchstmöglichen Dauerertrag zu erhalten.
-
Das Erzielen des höchstmöglichen Dauerertrags stellt keinesfalls das einzige und auch nicht zwangsläufig das beste Kriterium für ein erfolgreiches Ressourcenmanagement bei der Nutzung von Populationen dar. Beispielsweise könnte es wichtiger sein, langfristig stabile Arbeitsplätze für die Fischer zu erhalten oder die Biodiversität einer Region zu bewahren.
Die Fragilität festgesetzter Fangquoten, …
Um regelmäßig den höchstmöglichen Dauerertrag zu erzielen, gibt es zwei einfache Wege: durch festgesetzte Fangquoten und durch einen festgelegten Aufwand. Bei festgesetzten Fangquoten (engl. fixed quota; Abb. 14.30) wird einer Population jedes Jahr die gleiche Menge an Fischen entnommen – der maximale Dauerertrag. Das könnte dann funktionieren, wenn die Population dabei genau auf dem Gipfel ihrer Nettowachstumskurve bliebe – ob das tatsächlich so ist, ist die große Frage. Wenn ja, dann würde die Population nämlich durch Zuwanderung und Reproduktion jedes Jahr um genau so viele Individuen anwachsen, wie durch Fang entnommen werden. Würde die Zahl der Fische allerdings zufällig auch nur geringfügig unter diesen Wert sinken, bei der die Kurve den Gipfel erreicht – beispielsweise weil aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen weniger Individuen hinzukommen –, dann würde die Fangmenge den Populationszuwachs übersteigen. Folglich ginge die Populationsgröße unter den Wert am Scheitelpunkt der Kurve zurück. Hielte man weiterhin an der festgesetzten Fangquote in Höhe des höchstmöglichen Dauerertrags fest, ginge die Population immer weiter zurück, bis sie schließlich ganz erlischt. Ähnlich wäre es, wenn der höchstmögliche Dauertrag auch nur ein wenig zu hoch eingeschätzt würde – und verlässliche Schätzungen erweisen sich als äußerst schwierig. Auch in diesem Fall würde die Zahl der entnommenen Individuen stets die Zuwachsrate übersteigen und die Population würde ebenfalls aussterben. Kurzum: Eine festgesetzte Fangquote in Höhe des höchstmöglichen Dauerertrags könnte in einer vollständig vorhersagbaren Umwelt, deren Einflüsse alle genauestens bekannt sind, durchaus eine wünschenswerte und vernünftige Lösung darstellen. In der Realität mit schwankenden Umweltbedingungen und unzureichenden Daten als Grundlage sind solche festgesetzten Fangquoten eine offene Einladung zum Schritt ins Verderben.
Entnahme nach festgesetzten Fangquoten. Die Grafik zeigt eine einzelne Wachstumskurve (die durchgezogene Linie; Populationszuwachs im Verhältnis zur Populationsdichte, N) sowie zwei Linien für festgesetzte Fangquoten (gestrichelte Linien): eine für eine hohe Fangquote (hh) und eine für eine Fangquote in Höhe des höchstmöglichen Dauerertrags (hm). Die Pfeile geben zu erwartende Veränderungen der Abundanz unter dem Einfluss der Fangquote wieder, der die Pfeile am nächsten stehen. Die blauen Punkte repräsentieren Gleichgewichtszustände. Bei hoher Fangquote (hh) stellt sich erst dann ein Gleichgewicht ein, wenn die Population ausgestorben ist. Der höchstmögliche Dauerertrag wird mit der Fangquote hm erzielt, weil sie die Wachstumskurve am Scheitelpunkt berührt (bei der Dichte Nm). Populationen, die größer sind als Nm, werden durch diese Fangquote auf Nm reduziert, Populationen, die kleiner sind als Nm, werden ganz ausgerottet. K steht für die Umweltkapazität, also jene Populationsdichte, bei der sich die Population einpendeln wird, sofern keine Ausbeutung erfolgt
… bestätigt durch die Praxis
Trotzdem wird die Strategie festgesetzter Fangquoten häufig angewendet. Ein typisches Beispiel dafür bildet der Fang der Peruanischen Sardelle (Engraulis ringens; Abb. 14.31) in dem durch nährstoffreiches Auftriebswasser gespeisten Biom entlang der Westküste Südamerikas. Von 1960–1972 war dies die weltweit größte Fischereiwirtschaft und ein wichtiger Sektor der peruanischen Ökonomie. Auf den Rat von Fischereiexperten wurde der Fang auf die als höchstmöglichen Dauerertrag errechneten rund 10 Mio. t pro Jahr begrenzt. Trotzdem wurden die Kapazitäten der Fangflotte weiter ausgebaut, mit dem Ergebnis, dass der Fang 1972 einbrach. Wahrscheinlich war Überfischung zumindest eine der Hauptursachen für den Zusammenbruch, allerdings wurde der Effekt noch durch beträchtliche Schwankungen der Umweltbedingungen verstärkt. Darauf gehen wir weiter unten noch ein. Ein sofortiger Fangstopp wäre aus ökologischer Sicht sinnvoll gewesen, war aber politisch nicht durchsetzbar, denn zum damaligen Zeitpunkt hingen 20.000 Arbeitsplätze von der Sardellenindustrie ab. Daher gestattete die peruanische Regierung, den Fischfang fortzusetzen. Die Bestände benötigten allerdings 20 Jahre, um sich wieder zu erholen.
Fangmengen der Peruanischen Sardelle (Engraulis ringens) seit 1950. Auffällig ist der dramatische Zusammenbruch, der überwiegend auf Überfischung zurückzuführen war. Bis sich die Bestände wieder erholt hatten, vergingen 20 Jahre (nach Jennings et al. 2001)
Die relative Stabilität des Fangs durch Festlegung des Aufwands
Die zweite Möglichkeit, den höchstmöglichen Dauerertrag zu erzielen, ist den Aufwand festzulegen (engl. fixed effort). Das kann beispielsweise die Zahl der Trawler-Fangtage sein, wobei die Fangmenge mit der Größe der Population zunimmt (Abb. 14.32). Fällt in diesem Fall die Populationsdichte unter den Wert am Scheitelpunkt der Kurve, übersteigt die Zuwachsrate die entnommene Menge und die Population erholt sich wieder. Dadurch wird das Aussterberisiko erheblich reduziert. Nachteilig ist an dieser Strategie, dass die Erträge mit der Populationsgröße variieren – das heißt, es gibt gute, aber auch schlechte Jahre. Außerdem darf niemand einen höheren Aufwand betreiben, als vorgesehen. Der Fang des Pazifischen Heilbutts (Hippoglossus stenolepis) wird zum Beispiel durch saisonale Schonzeiten und durch Schutzzonen mit striktem Fangverbot, sogenannte No-Take-Zonen (Kap. 13), begrenzt. Allerding sind erhebliche Investitionen in Patrouillen erforderlich, um kontrollieren zu können, ob die Regelungen eingehalten werden.
Fang mit festgelegten Aufwand. Kurven, Pfeile und Punkte wie in Abb. 14.30. Der höchstmögliche Dauerertrag wird bei einem Aufwand Em erreicht, der bei der Dichte Nm und dem Ertrag hm zu einem stabilen Gleichgewicht führt. Bei etwas höherem Aufwand (Eh) sind sowohl die Gleichgewichtsdichte als auch der Ertrag geringer als bei Em, aber das Gleichgewicht ist dennoch stabil. Nur bei einem sehr viel höheren Aufwand (E0) kommt es zum Aussterben der Population
Umweltschwankungen – die Sardelle und El Niño
Die Fischerei übt zweifellos häufig einen starken Druck auf die Fischpopulationen aus. Oft ist der Zusammenbruch der Fischbestände in einem bestimmten Jahr allerdings auch auf außergewöhnlich ungünstige Umweltbedingungen zurückzuführen und nicht einfach nur auf Überfischung. Die Fangerträge der Peruanischen Sardelle (Engraulis ringens) brachen von 1972 auf 1973 zusammen (Abb. 14.31), aber bereits Mitte der 1960er-Jahre hatte es infolge eines El-Niño-Ereignisses einen kleinen Einbruch bei dem ansonsten stetigen Anstieg der Fangmengen gegeben. Bei einem El Niño strömt warmes tropisches Wasser von Norden an die Küste und bewirkt, dass hier nicht so viel nährstoffreiches Tiefenwasser aufsteigen kann wie sonst üblich. Dadurch verringert sich die Produktivität des Ökosystems an der peruanischen Küste. Bis zu diesem Zeitpunkt, 1973, hatte die kommerzielle Fischerei aber schon so stark zugenommen, dass das nächste El-Niño-Ereignis noch schwerwiegendere Folgen hatte. Zwischen 1973 und 1982 zeigten sich zwar Anzeichen einer Erholung der Fischbestände, aber mit dem nächsten El Niño 1983 folgte ein weiterer Zusammenbruch. Mit ziemlicher Sicherheit hätten sich diese El-Niño-Ereignisse nicht so gravierend ausgewirkt, wenn die Sardellen nur in geringem Ausmaß gefangen worden wären. Ebenso klar ist aber auch, dass sich die Geschichte der peruanischen Sardellenfischerei nicht einfach nur mit den Folgen der Überfischung erklären lässt.
Die Populationsstruktur und der Atlantische Kabeljau
Die Populationsstruktur der gefangenen Arten haben wir bislang noch gar nicht berücksichtigt. In den meisten Fällen ist für den Fang aber nur ein Teil der Population interessant – beispielsweise Fische einer bestimmten Größe, die sich für den Verkauf eignen. Auch der Populationszuwachs (engl. recruitment) ist in der Praxis ein komplexer Prozess, an dem viele Faktoren beteiligt sind: die Überlebensrate und Fruchtbarkeit der adulten Fische, die Überlebensrate und das Wachstum der Jungfische usw. Jeder dieser Parameter kann auf andere Weise auf Veränderungen der Populationsdichte und der Fangstrategie reagieren. Für die norwegische Kabeljaufischerei in arktischen Gewässern wurde ein Modell entwickelt, das einige dieser Variablen berücksichtigt. Die Populationen des Atlantischen Kabeljaus (Gadus morhua) bilden die am weitesten nördlich vorkommenden nutzbaren Fischbestände im Atlantik. Für Ende der 1960er-Jahre lagen Daten zu der Anzahl der Fische verschiedener Altersklassen vor. Anhand dieser Informationen wurden Vorhersagen zu den voraussichtlichen Fangmengen bei unterschiedlicher Fangintensität und Maschenweite der Schleppnetze getroffen. Dem Modell zufolge seien die langfristigen Aussichten für die Fischerei bei einer geringen Fangintensität von weniger als 30 % und großer Maschenweite der Netze am besten. Das gebe den Fischen die Gelegenheit zu wachsen und sich fortzupflanzen, bevor sie gefangen werden (Abb. 14.33). Die Empfehlungen des Modells wurden aber ignoriert und wie vorhergesagt brachen die Kabeljaubestände verheerend zusammen.
Vorhersagen zur Bestandsentwicklung des Atlantischen Kabeljaus (Gadus morhua) bei drei verschiedenen Fangintensitäten und drei unterschiedlichen Maschenweiten der Fangnetze. Bei weitmaschigen Netzen können mehr und größere Fische dem Fang entgehen. Beim höchsten Fangaufwand (45 %, untere Grafik) ist der Fang eindeutig nicht nachhaltig, und zwar unabhängig von der verwendeten Maschenweite. Die größten nachhaltigen Fangmengen sind bei geringem Aufwand (26 %, obere Grafik) und großer Maschenweite zu erzielen (nach Pitcher und Hart 1982, Foto: © Paul Nicklen/National Geographic Creative)
Aquakultur – ein immer stärker aufkommender Trend
Nachdem die Fischereiwirtschaft weltweit ins Stocken geriet, konnten die Verluste in der Versorgung mit Speisefischen zum Teil durch den immer stärker aufkommenden Trend zur Aquakultur aufgefangen werden (Abb. 14.27). Als Aquakultur (engl. aquaculture) bezeichnet man die kontrollierte Aufzucht von Speisefischen, Schalentieren und Algen in marinen Küstengewässern und im Süßwasser. Die Ursprünge der Aquakultur reichen weit zurück. Schon im Jahr 475 v. Chr. brachte Fan Lai ein Buch über die Grundlagen der Fischzucht heraus, in dem es auch um die Zucht von domestizierten Karpfen in Fischteichen in China geht. Den Beschreibungen zufolge begannen solche Fischzuchten wahrscheinlich bereits vor mindestens 4000 Jahren (FAO 2012). Die Aquakultur in dem Umfang, wie sie heute praktiziert wird, begann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also im Grunde etwa zur gleichen Zeit wie die Intensivierung der Landwirtschaft. Zu den wichtigsten Produkten der Aquakultur gehören Süßwasserfische wie Karpfen und Buntbarsche (Tilapien), aber auch Meeresfische wie Lachse (Abb. 14.34a). Die Produktion von Algen, die in zahlreichen Lebensmittelprodukten, in Form von Agar als Geliermittel in Desserts oder auch zur Herstellung der Algenröllchen bei Sushi Verwendung finden, von Muscheln wie Miesmuscheln oder Austern sowie von Krebstieren (Garnelen – „Shrimps“) nimmt ebenfalls zu. Die meisten Aquakulturen gibt es in Asien, insbesondere in China (Abb. 14.34b).
Heute stellen Aquakulturen eine Nahrungs- und Proteinquelle von weltweiter Bedeutung dar. Aufmerksamkeit haben sie aber auch aufgrund ihrer nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt erregt. Eines der damit einhergehenden Probleme ist die Zerstörung von Mangrovensümpfen an der Küste. Die Mangroven werden meist abgeholzt und die Wasserflächen zu Teichen für die Aquakultur umgewandelt, vor allem für die Garnelenzucht. Damit bilden sie weltweit die Hauptursache für den Verlust von Feuchtgebieten. Für die Betreiber sind die Garnelenteiche zwar rentabel, die externen Kosten in Form des Schwindens von Feuchtgebieten sind jedoch weitaus größer und müssen von der Gesellschaft getragen werden. Sie äußern sich beispielsweise im Verlust heimischer Fischarten (Gunawardena und Rowan 2005). Manche der in Aquakulturen gezüchteten Arten, das gilt vor allem für Lachse, werden in der Regel überwiegend mit wildgefangenen Futtertieren gefüttert. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sie gesundheitlich unbedenklich zum Verzehr durch den Menschen sind (Exkurs 14.6). Letztendlich führt dies aber in der Summe zu einem Nettoverlust an Fischprotein, da die Biomasse der produzierten Lachse geringer ist als die Biomasse der an sie verfütterten Fische. Das ergibt sich ganz zwangsläufig aus der Transfereffizienz zwischen den Ebenen der Nahrungskette (Abschn. 11.5). Weil Fische und Krebstiere in Aquakulturbetrieben in hoher Dichte gehalten werden, führt dies zudem häufig zu einer starken Nährstoffbelastung. Außerdem werden dem Futter für die Fische und Krebse in Aquakulturen ähnlich wie bei der Intensivtierhaltung (Exkurs 14.2) Antibiotika beigemengt, um das Wachstum zu beschleunigen und bakterielle Infektionen zu verhindern.
Exkurs 14.6 Aktueller ÖKOnflikt
Wir erkennen also auch hier, was wir bereits im Laufe der letzten Kapitel dieses Buches immer wieder gesehen haben: Unsere Umwelt stellt uns vor dringliche und komplexe Probleme. Ein besseres Verständnis der Ökologie wird uns dabei helfen, diese Probleme zu lösen, darauf beruht unsere ganze Hoffnung. Keines dieser Probleme kann jedoch für sich alleine betrachtet werden, isoliert vom gesellschaftlichen und ökonomischen Kontext oder von weiteren Prozessen an anderen Stellen irgendwo im globalen Ökosystem.
Aufgaben zur Wiederholung
-
1.
In welchem Umfang werden globale Umweltprobleme durch das Bevölkerungswachstum verursacht? Stellen Sie dieses Wachstum vergleichend anderen Ursachen des Wandels gegenüber.
-
2.
Erklären Sie, welche Auswirkungen die Altersstruktur einer Population auf das Bevölkerungswachstum in verschiedenen Regionen der Erde hat.
-
3.
Wie wirkt sich der globale Klimawandel auf Krankheiten und die Gesundheit des Menschen aus?
-
4.
Erläutern Sie, wie die Verwendung von synthetischen Stickstoffdüngern eine intensive Massentierhaltung weitab vom Ort der Produktion der Futterpflanzen für das Nutzvieh ermöglicht hat und warum dies Probleme der Umweltverschmutzung nach sich zieht.
-
5.
Inwiefern wirkt sich die menschliche Ernährung auf die Stickstoffbelastung aus?
-
6.
Was versteht man unter Biomagnifikation und warum gibt dieser Prozess Anlass zur Besorgnis?
-
7.
Warum verschärfen landwirtschaftliche Monokulturen die Schädlingsproblematik?
-
8.
Wie kommt es, dass die globale Nutzpflanzenproduktion in den letzten Jahrzehnten so erheblich zunehmen konnte, ohne dass dafür mehr Ackerflächen benötigt wurden? Warum könnte das Ende dieses Trends bevorstehen?
-
9.
Inwieweit untergraben klimatische Veränderungen die Effektivität der von der Fischereiwirtschaft verfolgten Fangstrategie des höchstmöglichen Dauerertrags von Fischbeständen?
Anspruchsvolle Aufgaben
-
1.
Warum ist die Stickstoffbelastung bei biologischem Anbau in der Regel geringer als bei konventionellen Anbaumethoden?
-
2.
Zu welchem Zweck – wenn überhaupt – ist eine Verwendung von Antibiotika in der Landwirtschaft und Aquakultur angebracht und warum? Aus welchen Gründen werden gegenwärtig in diesen Industriezweigen so große Mengen an Antibiotika eingesetzt?
-
3.
Nach dem Vorsorgeprinzip sollten jegliche Maßnahmen mit größter Vorsicht in Angriff genommen werden, sofern der Ausgang ungewiss ist, die potenziellen Risiken jedoch ausgesprochen hoch. Wie würden Sie dieses Prinzip anwenden, wenn Sie den zukünftigen Bedarf an Flächen für die Landwirtschaft ermitteln müssten?
7 Exkurs 14.6 Aktueller ÖKOnflikt
7 Aquakultur, Fettsäuren und die menschliche Gesundheit
Im Jahr 2008 erschien auf der Webseite ScienceDaily (www.sciencedaily.com) ein Artikel mit der Schlagzeile „Der beliebte Speisefisch Tilapia enthält potenziell gefährliche Fettsäurekombinationen“ (Wake Forest University 2008). Im Text des Artikels hieß es: „Aus Zuchtbetrieben stammende Tilapien, die zu den beliebtesten Speisefischen in Amerika gehören, enthalten nur sehr geringe Mengen der wertvollen Omega-3-Fettsäuren und, was vielleicht noch schlimmer ist, sehr hohe Konzentrationen an Omega-6-Fettsäuren, das ergaben neue Forschungen an der Wake Forest University School of Medicine. Nach Aussage der Forscher könnten die Fische durch diese Kombination eine potenziell gefährliche Nahrungsquelle für manche Patienten sein, die unter Herzerkrankungen, Arthritis, Asthma oder anderen allergischen oder Autoimmunerkrankungen leiden und besonders anfällig für eine ‚übersteigerte Entzündungsreaktion‘ sind. Solche Entzündungen verursachen nachweislich Schäden an Blutgefäßen, an Herz und Lunge, an den Geweben der Gelenke, an der Haut und am Verdauungstrakt.“
Der Artikel erregte weithin Aufmerksamkeit, denn viele Menschen essen vor allem deswegen Fisch, weil sie damit zum Wohle ihrer Gesundheit Omega-3-Fettsäuren aufnehmen möchten.
Warum enthalten die Tilapien mehr nachteilige Omega-6- und weniger wertvolle Omega-3-Fettsäuren? Fische synthetisieren ihre Fettsäuren nicht selbst, sondern reichern die in ihrer Nahrung enthaltenen Fettsäuren an – genau wie in manchen Tieren durch Biomagnifikation Pestizide und andere Giftstoffe akkumulieren (Abschn. 14.5). Algen haben einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Das gilt auch für Tilapien, die sich von Algen ernähren – was sie in der Natur auch tun. Problematisch wird es, wenn die Tilapien mit Mais oder Sojabohnen gefüttert werden, denn diese enthalten kaum Omega-3-Fettsäuren, dafür aber große Mengen Omega-6-Fettsäuren.
Ähnliche Probleme entstehen, wenn Lachse Futter mit den „falschen“ Fettsäuren erhalten. Das ist auch einer der Gründe dafür, warum Zuchtlachse zusätzlich zu dem Futter, das Mais und Sojabohnen enthält, in der Regel mit wildgefangenen Fischen gefüttert werden. Darüber hinaus wird mehr als die Hälfte der Weltproduktion an Fischöl aus wildgefangenen Fischen an Lachse in Aquakulturen verfüttert.
Tilapien können sich praktisch von allen Pflanzen- oder Algenarten ernähren. Sollten Aquakulturbetriebe, die Tilapien züchten, dazu angehalten werden, den Fischen Algen als Futter anzubieten, damit diese mehr wertvolle und weniger unerwünschte Fettsäuren enthalten? Sollte Fischfutter aus Mais und Sojabohnen mit Fischöl angereichert werden, um den Gehalt an erwünschten Fettsäuren zu erhöhen? Welche Vorteile und Probleme brächte dieser Ansatz mit sich?
7 Zusammenfassung
7 Der Verbrauch ökologischer Ressourcen durch den Menschen
In den letzten 50 Jahren erlebte die Welt einen explosionsartigen Anstieg von Wohlstand und Verbrauch und eine zunehmende Verstädterung. Im Jahr 2010 lebten weltweit erstmals genauso viele Menschen in Städten wie auf dem Land. Diese Trends belasten die Umwelt in einem noch nie dagewesenen Ausmaß.
7 Das Problem des Bevölkerungswachstums
Die Problematik der Überbevölkerung ist vielgestaltig: Die Gesamtzahl an Individuen, die Wachstumsraten und die Verteilung der Menschen, insbesondere im Verhältnis zu den Ressourcen, sind alle nicht auf Dauer tragbar. Vorhersagen zufolge werden sich die Wachstumsraten kontinuierlich verringern, aber die Dynamik des Wachstums in der Vergangenheit und die zunehmend überalterte Bevölkerung werden zwangsläufig weitere Probleme nach sich ziehen. Herauszufinden, wie groß die akzeptable Umweltkapazität der Erde für den Menschen ist, stellt eine nicht leicht zu bewältigende Herausforderung dar.
7 Ökologie und Gesundheit des Menschen
Biogeochemische Veränderungen des globalen Ökosystems bringen eine Reihe unterschiedlicher Probleme für die menschliche Gesundheit mit sich. Das Schwinden der schützenden Ozonschicht in der Stratosphäre, verursacht durch anthropogene chemische Verbindungen wie Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) oder steigende Konzentrationen natürlicher Produkte wie Distickstoffmonoxid, hat dazu geführt, dass mehr UV-Strahlung die Erdoberfläche erreicht, einhergehend mit einer höheren Hautkrebsrate. Aufgrund der globalen Erwärmung treten zunehmend häufiger extreme Klimaereignisse auf und sind dafür verantwortlich, dass die Zahl der Todesfälle und Krankenhausaufenthalte pro Jahr angestiegen ist. Durch die globalen Klimaveränderungen steigen auch die Inzidenz und Verbreitung von Infektionskrankheiten des Menschen. Diese und andere Einflüsse führen zu einer zunehmenden Zahl an Neuinfektionen, vielfach durch Übertragung von Tieren.
7 Kunstdünger und die Intensivierung der Landwirtschaft
Die zunehmende Verwendung synthetischer Stickstoffdünger hat eine Intensivierung der Landwirtschaft ermöglicht, einhergehend mit einer räumlichen Trennung der Tierhaltung in Massenbetrieben von den Feldern, auf denen die Futterpflanzen für diese Tiere angebaut werden. Da der Fleischkonsum global gesehen und in vielen Ländern angestiegen ist, müssen mehr Futterpflanzen angebaut werden. Es entstehen aber auch große Mengen tierischer Exkremente. Durch eine Ernährung mit geringerem Fleischanteil ließe sich die Belastung der Umwelt durch die Landwirtschaft verringern. In vielen westlichen Ländern, in denen sich der gegenwärtige Fleischkonsum negativ auf die Gesundheit auswirkt, wird eine solche Ernährung bereits empfohlen. Die übermäßige Düngung von Ackerflächen trägt ebenfalls erheblich zur Stickstoffbelastung bei.
7 Monokulturen, Schädlinge und Pestizide in der Landwirtschaft
Die Intensivierung der Landwirtschaft ging mit Monokulturen von Nutzpflanzen einher, die besonders anfällig für Schädlingsbefall sind. Durch den ungezügelten Einsatz chemischer Pestizide nach dem Zweiten Weltkrieg wurden häufig auch Prädatoren getötet, was zu einem raschen Populationswachstum neuer Schädlingsarten führte. Manche Pestizide wie DDT können sich biologisch anreichern. Diese Biomagnifikation kann sich auf Nichtzielorganismen wie Vögel schädigend auswirken. Ein weiteres Problem entsteht dadurch, dass Schädlinge rasch Resistenzen gegen chemische Pestizide entwickeln können. Biologische Methoden der Schädlingsbekämpfung bieten zahlreiche Vorteile, ebenso die integrierte Schädlingsbekämpfung, ein pragmatischer Ansatz, bei dem die eingeschränkte Verwendung von chemischen Substanzen mit biologischen Formen der Bekämpfung kombiniert wird.
7 Globaler Flächenverbrauch und andere Einschränkungen für eine weitere Intensivierung der Landwirtschaft
Der enorme Anstieg der landwirtschaftlichen Produktion in den letzten 50 Jahren beruhte darauf, dass der pro ackerbaulich genutzter Flächeneinheit erzielte Ertrag kontinuierlich zunahm. Eine weitere Zunahme wird jedoch durch Einschränkungen limitiert wie eine unzureichende Wasserversorgung zur Bewässerung sowie nachteilige Auswirkungen des globalen Klimawandels und der Luftverschmutzung. Zudem degradiert Ackerland zum Teil durch Versalzung oder geht durch die Ausbreitung städtischer Siedlungen verloren. Für die zunehmende Produktion flüssiger Biokraftstoffe werden ebenfalls Anbauflächen für nachwachsende Rohstoffe benötigt. Vermutlich steht global gesehen nicht genügend Land zur Verfügung, um den zukünftigen Bedarf an Nahrungsmitteln und Biokraftstoffen durch die landwirtschaftliche Produktion zu decken.
7 Nahrungsversorgung durch Fischerei und Aquakultur
Die meisten Fischereiressourcen unterlagen jahrzehntelang einem mangelhaften Management, denn oftmals orientierte man sich am Konzept des höchstmöglichen Ertrags, das schwankende Umweltbedingungen und komplexe ökologische Wechselwirkungen unberücksichtigt lässt. Besser geeignete Modelle wurden häufig aus politischen Gründen ignoriert.
Global gesehen stagniert der Fischfang schon seit mehreren Jahrzehnten. Dagegen haben sich in den letzten 20 Jahren zunehmend Aquakulturen ausgebreitet und sich weltweit zu einer immer wichtigeren Proteinquelle entwickelt. Ähnlich wie die Landwirtschaft bringen Aquakulturen aber auch bedeutende Probleme für die Umwelt mit sich.
Notes
- 1.
Alle Inhalte © 2005 Popular Science. A Time4 Media Company. Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion, im Ganzen oder auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.
Bibliographie
Kolbert, E. (2011) Enter the anthropocene: Age of man. National Geographic, 219, 60–85
World Health Organization (2013a) http://www.who.int/globalchange/summary/en/index4.html.
World Health Organization (2013b) Obesity and overweight, fact sheet #311. United Nations, Geneva, Switzerland. http://www.who.int/nutrition/topics/3_foodconsumption/en/
Cohen, J.E. (1995) How Many People Can the Earth Support?. WW. Norton & Co., New York
Population Reference Bureau (2006) http://www.prb.org/Publications/GraphicsBank/PopulationTrends.aspx.
Wackernagel, M., Schulz, N.B., Deumling, D., Callejas Linares, A., Jenkins, M., Kapos, V., Monfreda, C., Loh, J., Myers, M., Norgaard, R. & Randers, J. (2002) Tracking the ecological overshoot of the human economy. Proceedings of the National Academy of the USA, 99, 9266–9271
Shanklin, J. (2010) Reflections on the ozone hole. Nature, 465, 34–35
Montella, A., Gavin, A., Middleton, R., Autier, P. & Boniol. M. (2009) Cutaneous melanoma mortality starting to change: a study of trends in Northern Ireland. European Journal of Cancer, 45, 2360–2366
Sillmann, J. & Roekner E. (2008) Indices for extreme events in projections of anthropogenic climate change. Climatic Change, 86, 83–104
Zhang, Y., Bi, P., Hiller, J.E., Sun, Y. & Ryan, P. (2007) Climate variations and bacillary dysentery in northern and southern cities of China. Journal of Infection, 55, 194–200
Rogers, D.J. & Randolph, S.E. (2000) The global spread of malaria in a future, warmer world. Science, 489, 1763–1766
Jones, K.E., Patel, N.G., Levy, M.A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J.L. & Daszak, P. (2008). Global trends in emerging infectious diseases. Nature, 451, 990–994
Billen, G., Garnier, J., Thieu, V., Silvetre, M., Barles, S. & Chatzimpiros, P. (2012) Localising the nitrogen imprint of the Paris food supply: potential of organic farming and change in human diet. Biogeosciences, 9, 607–616
Howarth, R.W., Ramakrishna, K., Choi, E., Elmgren, R., Martinelli, L., Mendoza, A., Moomaw, W., Palm, C., Boy, R., Scholes, M. & Zhu Zhao-Liang (2005) Chapter 9: Nutrient management, responses assessment. In Ecosystems and Human Well-being, Volume 3, Policy Responses, the Millennium Ecosystem Assessment. Island Press, Washington, DC
Oerke, E.C. (2006) Crop losses to pests. Journal of Agricultural Science, 144, 31–43
Borga, K., Gabrielsen, G.W. & Skaare, J.U. (2001) Biomagnification of organochlorines along a Barents Sea food chain. Environmental Pollution, 113, 187–198
Ratcliffe, D.A. (1970) Changes attributable to pesticides in egg breakage frequency and eggshell thickness in some British birds. Journal of Applied Ecology, 7, 67–107
Smith, J.W. (1998) Boll weevil eradication: area-wide pest management. Annals of the Entomological Society of America, 91, 239–247
Pearson, D.E. & Callaway, R.M. (2003) Indirect effects of host-specific biological control agents. Trends in Ecology and Evolution, 18, 456–461
Cory, J.S. & Myers, J.H. (2000) Direct and indirect ecological effects of biological control. Trends in Ecology and Evolution, 15, 137–139
Louda, S.M., Kendall, D., Connor, J. & Simberloff, D. (1997) Ecological effects of an insect introduced for the biological control of weeds. Science, 277, 1088–1090
Herman, T.J.B. (2000) Developing IPM for potato tuber moth. Commercial Grower, 55, 26–28
Bringezu, S., Schutz, H., O’Brien, M., Kauppi, L., Howarth, R. & McNeely, J. (2009) Towards Sustainable Production and Use of Resources: Assessing Biofuels. International Panel for Sustainable Resource Management, United Nations Environment Program, Paris, France (http://www.unep.fr/scp/rpanel/biofuels.htm)
Intergovernmental Panel on Climate Change, (2007) Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, U.K
Avnerya, S., Mauzella, D.L., Liu, J. & Horowitz, L.W. (2011) Global crop yield reductions due to surface ozone exposure: 2. Year 2030 potential crop production losses and economic damage under two scenarios of O3 pollution. Atmospheric Environment, 45, 2297–2309
Howarth, R.W. & S. Bringezu (eds.). (2009) Biofuels: Environmental Consequences and Interactions with Changing Land Use. Proceedings of the International SCOPE Biofuels Project Rapid Assessment, 22–25 September 2008, Gummersbach Germany. (http://cip.cornell.edu/biofuels/)
Searchinger et al. (2008) Use of U.S. croplands for biofuels increases greenhouse gases through emissions from land use change. Science, 5867, 1238–1240
Khan, A.S., Sumaila, U.R., Watson, R., Munro, G. & Pauly, D. (2006) The nature and magnitude of global non-fuel fisheries subsidies. In: Catching More Bait: a Bottom-up Re-estimation of Global Fisheries Subsidies (U.R. Sumaila & D. Pauly, eds.), pp. 5–37. Fisheries Centre Research Reports Vol. 14, No. 6. Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver
Jennings, S., Kaiser, M.J. & Reynolds, J.D. (2001) Marine Fisheries Ecology. Blackwell Publishing, Oxford
Pitcher, T.J. & Hart, P.J.B. (1982) Fisheries Ecology. Croom Helm, London
FAO (2012) Milestones in Aquaculture Development. Food and Agricultural Organization, United Nations, Rome, Italy. (http://www.fao.org/docrep/field/009/ag158e/AG158E02.htm).
Gunawardena, M. & Rowan, J.D. (2005) Economic valuation of a mangrove ecosystem threatened by shrimp aquaculture in Sri Lanka. Journal of Environmental Management, 36, 535–550
Cohen, J.E. (2001) World population in 2050: assessing the projections. In: Seismic Shifts: The Economic Impact of Demographic Change (J.S. Little & R.K. Triest, eds.), pp. 83–113. Conference Series No. 48. Federal Reserve Bank of Boston, Boston
Cohen, J.E. (2003) Human population: the next half century. Science, 302, 1172–1175
Cohen, J.E. (2005) Human population grows up. Scientific American, 293(3), 48–55
Kalkstein, L.S. & Greene, J.S. (1997) An evaluation of climate/mortality relationships in large US cities and the possible impacts of climate change. Environmental Health Perspectives, 105, 84–93
UNEP (2014) Assessing global land use: Balancing consumption with sustainable supply. United Nations Environment Programme, Paris, France
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011) World Population Prospects: The 2010 Revision. United Nations, New York
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2017 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
Begon, M., Howarth, R.W., Townsend, C.R. (2017). Die Ökologie des Menschen: Bevölkerungswachstum, Krankheiten und Versorgung mit Nahrung. In: Ökologie. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49906-1_14
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-49906-1_14
Published:
Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-49905-4
Online ISBN: 978-3-662-49906-1
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)