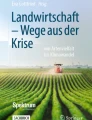Zusammenfassung
Georg Simmel hat auf eine soziale Regelmäßigkeit aufmerksam gemacht, der zufolge dort, wo bestehende soziale Einheiten „in eine umfassende Einheit zusammengezwungen“ werden, oft eine „gesteigerte Unverträglichkeit“ und „stärkere gegenseitige Repulsion“ die Folge ist, denn die zwangsweise Verbindung bewirke eine „gegenseitige Reibung“, eine „Geltendmachung der Gegensätze, die ohne dies Aneinanderrücken innerhalb der Einheit nicht entstanden wäre“.
*Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete und (insbesondere im vierten Kapitel) ergänzte Fassung eines Beitrags der ersten Auflage. Seinerzeit war Gerhard Wagner der zweite Autor neben Peter Gostmann. Auf seinen Vorschlag hin hat die Bearbeitung neben Gostmann Grzegorz Adamczyk übernommen und wird forthin als Ko-Autor geführt. Die Autoren danken Wagner für seine großzügige Mit- bzw. Vorarbeit.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
Georg Simmel (1992), Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Gesamtausgabe, Bd. 11. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 815.
- 2.
Georg Simmel (1992), a. a. O., S. 815.
- 3.
Hagen Schulze (1999), Staat und Nation in der europäischen Geschichte- München: Beck, S. 21.
- 4.
Hagen Schulze (1999), a. a. O., S. 82–83, 117–118.
- 5.
Hedley Bull (1977), The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics. London: Macmillan, S. 255.
- 6.
Robert O. Keohane und Stanley Hoffmann (1991), „Institutional change in Europe in the 1980s“, in: dies. (Hg.), The New European Community. Decisionmaking and Institutional Change. Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press, S. 1–39; R.A.W. Rhodes, Ian Bache und Stephan George (1996), „Political networks and policy-making in the European Union“, in: Liesbet Hooghe (Hg.), Cohesion Policy and European Integration. Building Multi-Level Governance. Oxford, New York: Oxford University Press, S. 367–387.
- 7.
Alain Mine (1993), Le nouveau moyen age. Paris: Gallimard; Ole Waever (1995), „Identity, integration and security. Solving the sovereignty puzzle in E.U. studies“, in: Journal of International Affairs 48, S. 389–431; Manuel Castells (2003), „Die Vereinigung Europas: Globalisierung, Identität und der Netzwerkstaat“, in: ders., Das Informationszeitalter 3. Jahrtausendwende. Opladen: Leske + Budrich, S. 355–384.
- 8.
Ole Wrever (1995), a. a. O., S. 394 und S. 404.
- 9.
Ole Waever (1995), a. a. O., S. 422.
- 10.
Ernest Renan (1993), „Was ist eine Nation? Vortrag in der Sorbonne am 11. März 1882“, in: Michael Jeismann und Henning Ritter (Hg.), Grenzfälle. Über neuen und alten Nationalismus. Leipzig: Reclam, S. 290–311, hier S. 310.
- 11.
Jürgen Habermas (1998), Die postnationale Konstellation. Politische Essays. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- 12.
Ole Waever (1995), a. a. O., S. 406.
- 13.
Max Weber (1980), Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Verstehenden Soziologie. Tübingen: Mohr, S. 514–515.
- 14.
Max Weber (1980), a. a. O., S. 515.
- 15.
Avner Greif (1997), „Cultural beliefs as a common resource in an integrating world“, in: Partha Dasgupta, Karl-Göran Mäler und Alessandro Vercelli (Hg.), The Economics of Transnational Commons. Oxford: Clarendon, S. 238–296, hier S. 239.
- 16.
Max Weber (1980), a. a. O., S. 520.
- 17.
Pierre Bourdieu (1997), „Ökonomisches Kapital – Kulturelles Kapital – Soziales Kapital“, in: ders., Die verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zu Politik & Kultur 1. Hamburg: VSA, S. 49–79.
- 18.
Max Weber (1980), a. a. O., S. 28.
- 19.
Lutz Niethammer (2000), Kollektive Identität. Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur. Reinbek: Rowohlt. S. 55.
- 20.
Lutz Niethammer (2000), a. a. O., S. 55. Vgl. Carolin Emcke (2000), Kollektive Identitäten. Sozialphilosophische Grundlagen. Frankfurt am Main: Campus; Udo Tietz (2002), Die Grenzen des Wir. Eine Theorie der Gemeinschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp; Hans Bernhard Schmid (2005), „Wir-Identität: reflexiv und vorreflexiv“, in: Deutsche Zeitschrift für Soziologie 53, S. 365–376.
- 21.
Aristoteles (1968), Topik (Organon V), Hamburg: Meiner, 9/103a.
- 22.
Saul A. Kripke (1981), Name und Notwendigkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 10.
- 23.
Saul A. Kripke (1981), a. a. O., S. 26 und S. 121.
- 24.
Saul A. Kripke (1981), S. 154.
- 25.
Vgl. nur Harrison C. White (1992), Identity and Control. A Structural Theory of Social Action. Princeton: Princeton University Press; Margaret R. Somers (1994), „The narrative construction of identity. A relational and network approach“, in: Theory and Society 23, S. 605–649.
- 26.
Ernest Renan (1993), a. a. O., S. 308–309; Max Weber (1980), a. a. O., S. 514–516; Benedict Anderson (1996), Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts. Frankfurt am Main, New York: Campus, S. 14–17.
- 27.
M. Rainer Lepsius (1982), „Nation und Nationalismus in Deutschland“, in: Heinrich August Winkler (Hg.), Nationalismus in der Welt von heute. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 12–27.
- 28.
Eric Hobsbawm (1983), „Introduction: inventing traditions“, in: ders. und Terence Ranger, (Hg.), The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, S. 1–14, hier S. 1.
- 29.
Nelson Goodman (1984), Weisen der Welterzeugung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 127–130; Arthur C. Danto (1984), Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 256.
- 30.
Ernest Renan (1993), a. a. O., S. 309.
- 31.
Adam Mickiewicz (1994), „Die Bücher des polnischen Volkes. Von der Erschaffung der Welt bis zum Leidenstod der polnischen Nation“, in: ders., Dichtung und Prosa. Ein Lesebuch. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 304–316, hier S. 316.
- 32.
Andreas Suter (1999), „Nationalstaat und die ‚Tradition von Erfindung‘. Vergleichende Überlegungen“, in: Geschichte und Gesellschaft 25, S. 480–503.
- 33.
Andreas Suter (1999), a. a. O., S. 482.
- 34.
Alexis de Tocqueville (1978), Der alte Staat und die Revolution. München: dtv.
- 35.
Max Weber (1980), a. a. O., S. 534.
- 36.
Max Weber (1980), a. a. O., S. 535.
- 37.
Max Weber (1980), a. a. O., S. 535.
- 38.
Georg Simmel (1995), „Philosophie der Mode“, in: ders., Philosophie der Mode. Die Religion. Kant und Goethe. Schopenhauer und Nietzsche. Gesamtausgabe, Bd. 10. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 7–37, hier S. 12.
- 39.
Georg Simmel (1995), a. a. O., S. 12.
- 40.
Georg Simmel (1992), a. a. O., S. 826.
- 41.
Max Weber (1980), a. a. O., S. 237.
- 42.
Max Weber (1980), a. a. O., S. 239.
- 43.
Jan Assmann (2000), Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München: Beck.
- 44.
Andreas Suter (1999), a. a. O., S. 482.
- 45.
Ernest Renan (1993), a. a. O., S. 308.
- 46.
Pierre Bourdieu (1997), a. a. O., S. 63.
- 47.
Pierre Bourdieu (1997), a. a. O., S. 76.
- 48.
Pierre Bourdieu (1976), Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabytischen Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 346.
- 49.
Pierre Bourdieu (1997), a. a. O., S. 77.
- 50.
Pierre Bourdieu (2001a), Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 311.
- 51.
Pierre Bourdieu (2001a), a. a. O., S. 311.
- 52.
Benedict Anderson (1996), a. a. O., S. 15.
- 53.
Ernest Renan (1993), a. a. O., S. 307.
- 54.
Max Weber (1980), a. a. O., S. 20.
- 55.
Pierre Bourdieu (2001b), Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 30.
- 56.
Max Weber (1980), a. a. O., S. 28.
- 57.
Pierre Bourdieu (1993), „Über einige Eigenschaften von Feldern“, in: ders., Soziologische Fragen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 107–114, hier S. 108.
- 58.
Michiya Shimbori, Hideo Ikeda, Tsuyoshi Ishida und Motô Kondô (1963), „Measuring a Nation’s Prestige“, in: American Journal of Sociology 69, S. 63–68. Vgl. W. Lloyd Warner, Marchia Meeker und Kenneth Eells (1957), Social Class in America. A Manual of Procedure for the Measurement of Social Status. Gloucester, Mass.: Smith.
- 59.
M.D.R. Evans und Jonathan Kelley (2002), „National Pride in the Developed World. Survey Data from 24 Nations“, in: International Journal of Public Opinion Research 14, S. 303–338, hier S. 303.
- 60.
M.D.R. Evans und Jonathan Kelley (2002), a. a. O. Vgl. https://www.gesis.org/issp/modules/issp-modules-by-topic/national-identity (Letzter Zugriff: 08.03.2020).
- 61.
Bernd Wegener (1985), „Gibt es Sozialprestige?“, in: Zeitschrift für Soziologie 14, S. 209–235, hier S. 219.
- 62.
Jürgen Mackert (2004), „Staatsbürgerschaft. Die sozialen Mechanismen interner Schließung“, in: ders. (Hg.), Die Theorie sozialer Schließung. Tradition, Analysen, Perspektiven. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 257–272.
- 63.
Bernd Wegener (1985), a. a. O., S. 229.
- 64.
Bernd Wegener (1985), a. a. O., S. 222.
- 65.
Milton Lodge (1981), Magnitude Scaling. Quantitative Measurement of Opinions. Newbury Park London New Delhi: Sage; Stanley S. Stevens (1986), Psychophysics. Introduction to its Perceptual, Neural, and Social Prospects. New Brundwick, Oxford: Transaction; Bernd Wegener (1988), Kritik des Prestige. Opladen: Westdeutscher Verlag; Siegfried Schumann (2000), „Zur Verwendung von Magnitude-Skalen in schriftlichen Umfragen zur politischen Einstellungsforschung“, in: Jan van Deth, Hans Rattinger und Edeltraud Roller (Hg.), Die Republik auf dem Weg zur Normalität? Wahlverhalten und politische Einstellungen nach acht Jahren Einheit. Opladen: Leske + Budrich, S. 411–435.
- 66.
Siegfried Schumann (2000), a. a. O., S. 411.
- 67.
Grzegorz Adamczyk und Peter Gostmann (2016), „Application of the Magnitude scale as a device of measurement of social prestige. Based on empirical research in Poland and Germany“. Presentation at the Conference: Methodological Inspirations 2016: Quantitative Research in Social Science – Challenges and Problems, Warsaw, 28.–30.09.2016.
- 68.
Siegfried Schumann (2000), a. a. O., S. 431–432.
- 69.
Vgl. Earl Babbie (2005), The Basics of Social Research. Belmont: Thomson, Wadsworth, S. 197–198.
- 70.
Wir verzichten an dieser Stelle wie auch im Folgenden darauf, Szenarien der Variablenzusammenfassung und weiteren Auswertung von im Sinne der MNPS erstellten Datensätzen zu entwerfen.
- 71.
Ernest Renan (1993), a. a. O., S. 308.
- 72.
Vgl. nur Markus Schroer (2008), „Individualisierung“, in: Nina Baur, Hermann Korte, Martina Löw und ders. (Hg.), Handbuch Soziologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 139–161.
- 73.
Dieter Langewiesche (2000), Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa. München: Beck, S. 23.
- 74.
Avner Greif (1997), a. a. O., S. 239.
- 75.
M.D.R. Evans und Jonathan Kelley (2002), a. a. O., S. 305–308.
- 76.
Michiya Shimbori, Hideo Ikeda, Tsuyoshi Ishida und Motô Kondô (1963), a. a. O., S. 66–67.
- 77.
Homi K. Bhabha (2000), Die Verortung der Kultur, Tübingen: Staufenberg.
- 78.
Hartmut Kaelble (2002), „Das europäische Selbstverständnis und die europäische Öffentlichkeit im 19. und 20. Jahrhundert“, in: ders., Martin Kirsch und Alexander Schmidt-Gernig (Hg.), Transnationale Öffentlichkeiten und Identitäten im 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main, New York: Campus, S. 85–109.
- 79.
Ulrich Beck und Edgar Grande (2006), Cosmopolitan Europe. London: Polity Press.
- 80.
Vgl. bereits unsere Fallstudie: Grzegorz Adamczyk und Peter Gostmann (2007), Polen zwischen Nation und Europa. Zur Konstruktion kollektiver Identität im polnischen Parlament. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2021 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Adamczyk, G., Gostmann, P. (2021). Die Macht der Ehre*. In: Gostmann, P., Merz-Benz, PU. (eds) Macht und Herrschaft. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31608-2_7
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-31608-2_7
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-31607-5
Online ISBN: 978-3-658-31608-2
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)